ADHS objektiv messen? Zur Neuropsychologie von ADHS
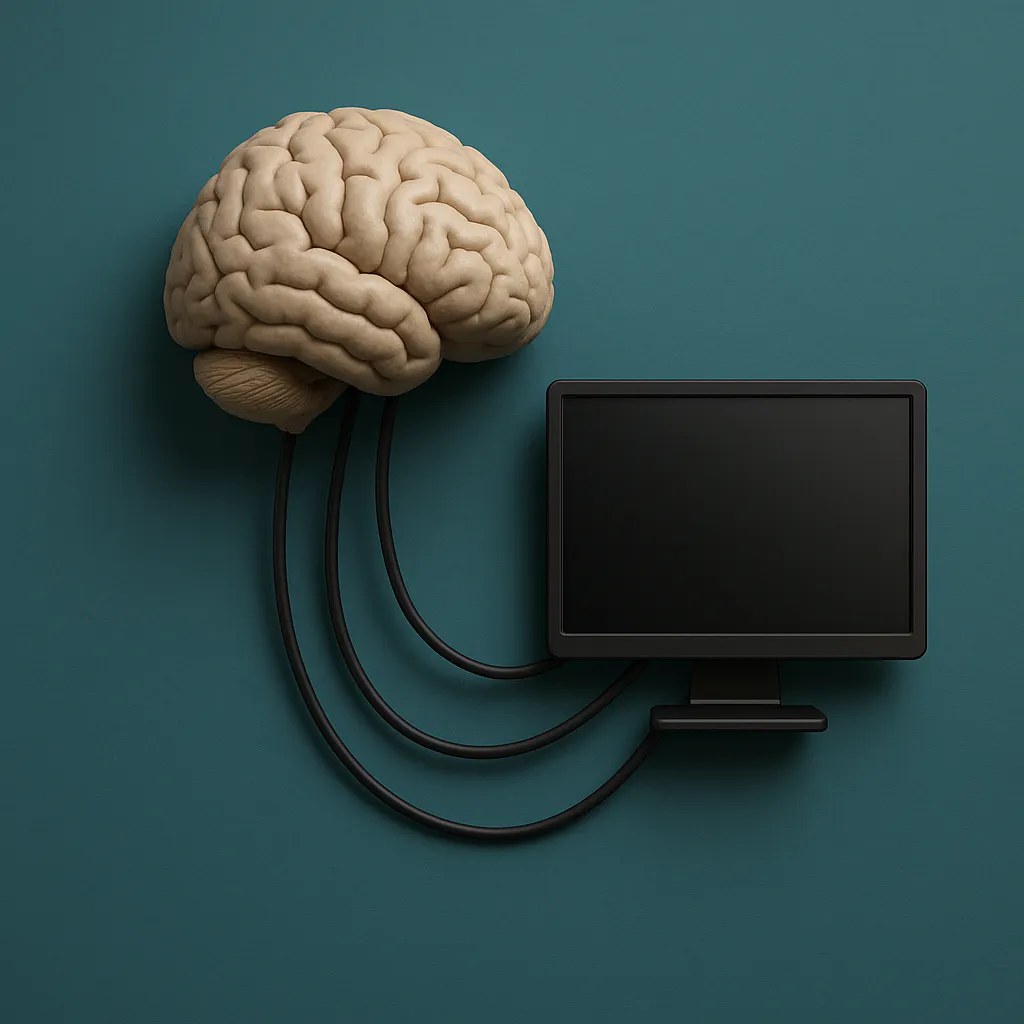
Was der Comprehensive Attention Test (CAT) wirklich leistet – und warum Tests niemals reichen
Podcast-Version (NotebookLM)
Die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist komplex – besonders im Erwachsenenalter oder bei atypischer Symptomkonstellation. Viele Betroffene suchen jahrelang nach einer Erklärung für ihre innere Unruhe, ihre emotionale Impulsivität, ihre chronische Erschöpfung oder das Gefühl, irgendwie „nicht steuerbar“ zu sein. Inmitten dieser Suche entsteht oft ein großer Wunsch nach objektiver Diagnostik: einem Verfahren, das verlässlich zeigt, ob ADHS vorliegt oder nicht.
Ein vielversprechender Ansatz kommt aus Südkorea: der Comprehensive Attention Test (CAT). In einer groß angelegten Studie mit über 11.000 Proband:innen wurde geprüft, wie gut der CAT – unterstützt durch maschinelles Lernen – zur ADHS-Diagnostik beitragen kann. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick beeindruckend. Doch eine differenzierte Betrachtung zeigt: Auch dieser Test ist kein Diagnoseschlüssel, sondern allenfalls ein wichtiges Werkzeug im größeren diagnostischen Puzzle.
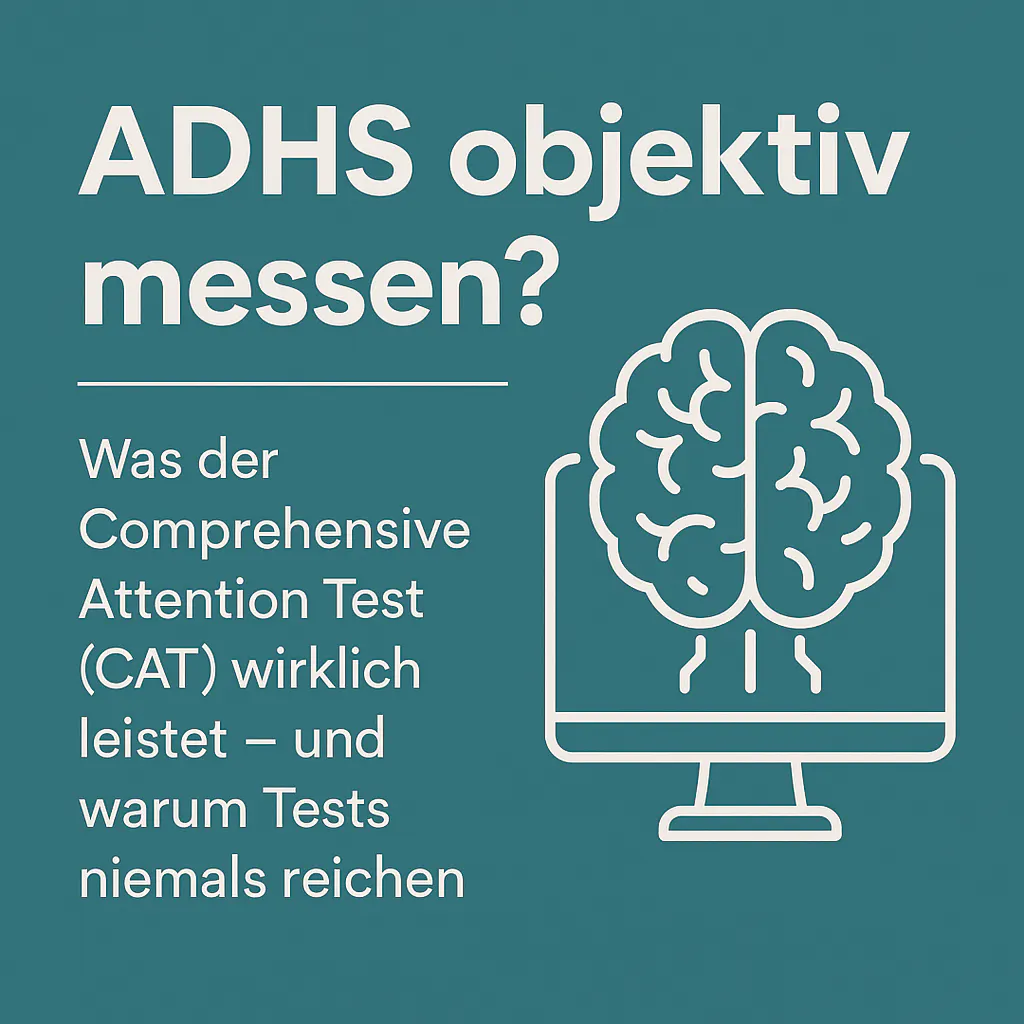
Was ist der CAT – und wie funktioniert er?
Der Comprehensive Attention Test (CAT) ist ein computergestützter, modular aufgebauter Test, der unterschiedliche Aspekte von Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis abbildet. Er besteht aus sechs eigenständigen Subtests, die insgesamt etwa 50–60 Minuten dauern. Während der Durchführung werden verschiedene Kennwerte erfasst:
Reaktionszeiten
Fehlerarten (Auslassungsfehler, Kommissionsfehler)
Reaktionskonsistenz (Standardabweichung)
Sensitivitäts- und Bias-Indizes (d’, β)
sowie ein standardisierter Aufmerksamkeitsquotient (AQ) für jede Teilkomponente.
Die sechs Subtests im Überblick:
Visuell selektive Aufmerksamkeit (VSA): Testet die Fähigkeit, visuelle Zielreize zuverlässig zu identifizieren und irrelevante Informationen zu ignorieren. Häufige Fehler bei ADHS: verspätete Reaktion oder Fehlreaktion auf irrelevante Reize.
Auditiv selektive Aufmerksamkeit (ASA): Das akustische Pendant zur VSA. Getestet wird die Fähigkeit, sich bei akustischen Reizen selektiv auf Zielsignale zu konzentrieren – eine häufige Alltagsherausforderung bei ADHS.
Daueraufmerksamkeit (SA): Misst die Stabilität der Aufmerksamkeit über längere Zeiträume. ADHS-Betroffene zeigen oft eine abfallende Leistung im Testverlauf und zunehmende Reaktionszeitvariabilität.
Interferenzkontrolle (ISA / Flanker-Test): Bewertet die Fähigkeit, trotz konkurrierender Reize den Fokus auf zielrelevante Informationen zu halten. Die hohe Vorhersagekraft dieses Subtests spricht für die Relevanz von Inhibitionsdefiziten bei ADHS.
Geteilte Aufmerksamkeit (DA): Misst die Fähigkeit, gleichzeitig auf visuelle und auditive Reize zu reagieren. Besonders aussagekräftig für Alltagssituationen mit hoher Reizdichte – etwa in der Schule oder im Berufsleben.
Räumliches Arbeitsgedächtnis (WM): Bewertet die Fähigkeit, visuell-räumliche Informationen kurzfristig zu speichern und in richtiger Reihenfolge abzurufen. Dieser Subtest war in der Studie am wenigsten aussagekräftig für die ADHS-Differenzierung.
Was zeigt die Studie von Cha et al. (2025)?
In einer beeindruckend großen Stichprobe von 11.429 Teilnehmern untersuchten die Autor:innen, wie gut sich ADHS allein anhand der CAT-Ergebnisse vorhersagen lässt – gestützt durch acht verschiedene Machine-Learning-Modelle, darunter Gradient Boosting und Support Vector Machines (SVM).
Die zentralen Ergebnisse:
Hohe Spezifität:
Das beste Modell (SVM) erreichte eine Spezifität von 0.98 – das bedeutet: Personen ohne ADHS wurden in 98 % der Fälle korrekt als „nicht betroffen“ erkannt. Auch das Gradient Boosting-Modell schnitt mit 0.96 hervorragend ab.Flanker-Test als starker Einzelprädiktor:
Besonders der ISA-Subtest (Flanker-Test) zeigte allein eine Genauigkeit von 0.92 mit einer Spezifität von 0.98. Das unterstreicht, dass Inhibitionsprobleme (also die Schwierigkeit, irrelevante Reize zu unterdrücken) ein zentrales Unterscheidungsmerkmal von ADHS darstellen.Geringer Beitrag des räumlichen Arbeitsgedächtnisses:
Der Subtest zum visuellen Arbeitsgedächtnis trug kaum zur Differenzierung zwischen ADHS und Kontrollgruppe bei. Dies spricht dafür, dass nicht alle exekutiven Teilfunktionen bei ADHS gleichermaßen betroffen sind – und das Arbeitsgedächtnis möglicherweise kompensiert werden kann.Symptomstärke und Komorbiditäten beeinflussen die Vorhersagekraft:
Bei ausgeprägter ADHS-Symptomatik und komorbiden externalisierenden Störungen (z. B. oppositionelles Verhalten) war die Klassifikationsgenauigkeit besonders hoch – bis zu 0.94.
Bei internalisierenden Komorbiditäten (z. B. Depression, Angst) fiel die Modellleistung deutlich ab – z. B. auf 0.56–0.71.
Auch bei milden Symptomen oder kompensierten Präsentationen (z. B. bei Frauen) waren die Ergebnisse weniger zuverlässig.
Interpretation:
Diese Ergebnisse spiegeln gut wider, was viele Praktiker:innen seit Jahren berichten:
„Klassisches ADHS“ mit impulsivem, hyperaktivem oder störendem Verhalten lässt sich leichter erkennen – auch mit Tests. Doch leise, kompensierte, internalisierte Formen sind schwerer zu fassen.
Selbst komplexe Machine-Learning-Modelle stoßen hier an ihre Grenzen.
Und genau bei dieser Gruppe bzw. Differentialdiagnostik bräuchten wir ja den Test, oder? Denn klare ADHS-”Fälle” erkennt man als Kliniken ja eben auch so. Und besonders das “Ausschliessen” von ADHS stösst dann schnell an seine Grenzen, da es sich ja um ein Spektrum handelt, nicht um eine kategoriale Störung mit einem klaren Cut-off.
Ein starker Test – und trotzdem kein Ersatz für klinische Diagnostik
Trotz aller Differenzierungskraft gilt: Der CAT ist ein spezialisiertes Instrument zur Abbildung von Leistungsprofilen – keine Diagnosemaschine. Genau das betonen auch die internationalen und deutschen Leitlinien:
🔍 ADHS darf weder durch einen Test noch durch einen Fragebogen allein bestätigt oder ausgeschlossen werden.
– S3-Leitlinie ADHS im Erwachsenenalter, AWMF, 2023
Und dennoch zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild:
Viele psychologische oder psychiatrische Ambulanzen verlassen sich auf Einzeltests, zum Teil auf veraltete Verfahren (z. B. d2, TAP), zum Teil auf Checklisten wie das ASRS. Häufig fehlt die Exploration der Kindheit, es gibt keine Fremdanamnese, keine Differenzialdiagnostik – und stattdessen ein automatisiertes Urteil auf Basis von Grenzwerten.
Problematisch daran:
Die Tests finden in strukturierten, reizarmen Umgebungen statt – das exakte Gegenteil des neurodivergenten Alltags.
Gute Testergebnisse können Kompensation oder Maskierung bedeuten – nicht Gesundheit.
Schlechte Ergebnisse können durch Stress, Trauma, Depression, Schlafmangel oder andere Störungen verursacht sein – nicht zwangsläufig durch ADHS.
Die Folge: Viele „still betroffene“ Menschen werden übersehen.
Andere erhalten fragwürdige ADHS-Diagnosen, obwohl andere Ursachen ursächlich sind – etwa Trauma, chronischer Stress, Autismus oder Bindungsstörungen.
Fazit: Der CAT kann helfen – aber er braucht Kontext
Die Studie von Cha et al. liefert beeindruckende Hinweise auf die diagnostische Relevanz neuropsychologischer Testverfahren, insbesondere wenn sie differenziert und intelligent ausgewertet werden. Der CAT ist dabei deutlich präziser als viele gängige Kurztests.
Aber:
🧠 ADHS ist keine Rechenaufgabe. Sondern ein Beziehungsthema.
Diagnostik braucht Erfahrung, Kontext, Empathie – und die Bereitschaft, die Lebensrealität der Betroffenen zu verstehen. Der CAT kann Teil dieses Prozesses sein, aber niemals sein Ersatz.
Erhalte weitere Beiträge wie diesen über den Newsletter
Tausch dich mit mir und weiteren Mitgliedern in der Skool Community von ADHSSpektrum aus
📚 Quelle
Cha KS, Kim B, Lee JY, Yoo H. Prediction of attention deficit hyperactivity disorder using the comprehensive attention test: a large-scale machine learning approach. Front Psychiatry. 2025 May 27;16:1574615. doi: 10.3389/fpsyt.2025.1574615. PMID: 40496821; PMCID: PMC12149198.


