Die stille Macht: Das European Digital Media Observatory (EDMO)
Es beginnt harmlos: Ein observatory, ein neutrales Labor für Medienanalysen, ein Zusammenschluss kluger Köpfe im Dienste der Wahrheit. So präsentiert sich das European Digital Media Observatory (EDMO), eine von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene Initiative zur Bekämpfung von Desinformation. Wissenschaftlich, überparteilich, evidenzbasiert – so die Selbstdarstellung.
Doch wer sich länger mit dem Projekt befasst, erkennt: EDMO ist weniger eine neutrale Beobachtungsstelle als ein infrastruktureller Knotenpunkt eines neuen „Wahrheitsregimes“, das im Schatten digitaler Gesetzgebungen wächst. Ein Netzwerk, das sich als Wissenschaft ausgibt, aber politisch ist. Als zivilgesellschaftlich erscheint, aber staatlich finanziert ist. Als plural daherkommt, aber normativ geschlossen operiert. Wer EDMO verstehen will, muss hinter die Kulissen blicken – in die Logik einer diskursiven Ordnung, die Wahrheit verwaltet wie ein Verwaltungsakt.
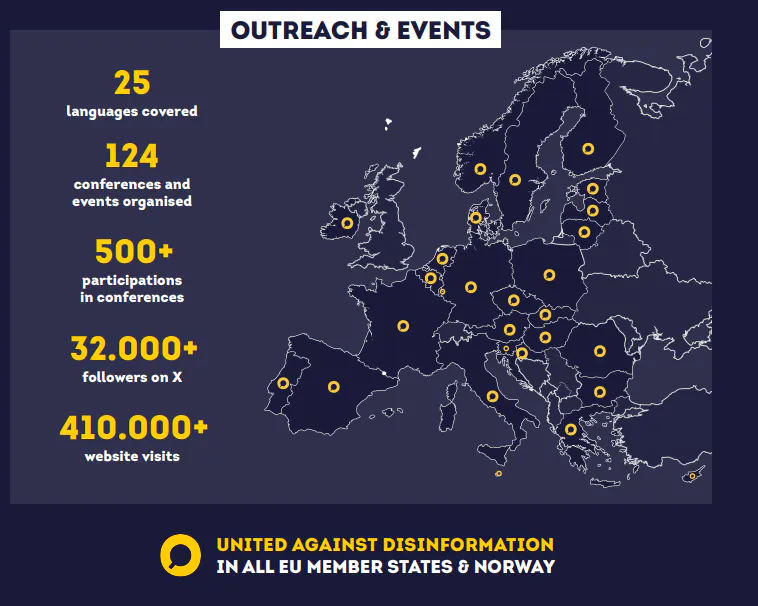
27 Millionen Gründe für Loyalität
EDMO wurde bislang mit mindestens 27 Millionen Euro aus EU-Mitteln finanziert – verteilt über mehrere Projektphasen (2019–2025), mit steigenden Beträgen und wachsender Reichweite. Die erste Tranche diente der Einrichtung der zentralen Plattform (2,5 Mio. €), es folgten über 11 Mio. € für regionale Hubs und zuletzt rund 8 Mio. € für sechs neue nationale Knotenpunkte.
Diese Gelder stammen primär aus dem „Connecting Europe Facility“ und dem „Digital Europe Programme“. Doch bereits hier beginnt die Unschärfe: Die exakte Aufschlüsselung ist intransparent. Der Europäische Rechnungshof bemängelt fehlende Klarheit über Doppelstrukturen und Ressourceneinsätze. Zahlreiche Maßnahmen überschneiden sich mit bereits bestehenden Projekten (etwa SOMA oder Code of Practice-Prozesse). Die Zahl 27 Millionen ist konservativ – sie könnte höher liegen, wenn man indirekte Zuwendungen, Plattform-Kooperationen und Drittmittel berücksichtigt.
Wichtig ist jedoch nicht nur die Summe, sondern ihr Ursprung: EDMO ist ein vollständig von der EU-Kommission abhängiges Konstrukt. Es ist, mit einem Begriff Bourdieu’s gesprochen, ein Instrument diskursiver Hegemonieproduktion unter dem Deckmantel evidenzbasierter Rationalität.
Wer spricht, wenn EDMO spricht?
EDMO ist kein einzelnes Institut, sondern ein verflochtenes Netzwerk aus Akademien, Fact-Checkern, zivilgesellschaftlichen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Medien und Plattformunternehmen. Die 14 regionalen Hubs reichen von Italien über die Benelux-Staaten bis nach Bulgarien – und beinhalten teilweise Organisationen mit direkten oder indirekten Verbindungen zu EU-Institutionen, Stiftungen (wie der Open Society Foundation), Ministerien oder globalen Plattformakteuren (Google, Meta).
Ein Beispiel: Die bulgarische Plattform „Factcheck.bg (Opens in a new window)“ ist Teil von EDMO, erhielt aber auch Gelder vom US-Außenministerium, der NATO und der Open Society. Ähnliche Konstruktionen finden sich in fast allen Ländern. Es entsteht ein Bild eines Netzwerks, das nicht durch kritische Unabhängigkeit, sondern durch kooperative Loyalität gegenüber politisch gewünschten Narrativen zusammengehalten wird. EDMO ist nicht pluralistisch. EDMO ist ein harmonisiertes Informationskartell mit akademischem Anstrich.
Was ist Desinformation – und wer definiert sie?
Desinformation ist das neue Schreckgespenst Europas – aber was sie ist, bleibt vage. EDMO behauptet, auf „wissenschaftlicher Evidenz“ zu operieren. Doch wer die Guidelines, Reports und Tools durchliest, erkennt: Desinformation ist ein bewegliches Ziel, ein Containerbegriff. Mal bedeutet sie „falsche Behauptung“, mal „irreführender Kontext“, mal „Fehlinterpretation“. Was sie nie ist: Eine staatlich verbreitete Narrative, eine journalistische Entgleisung, eine ideologisch begründete Verzerrung von Fakten.
Die Definitionsmacht liegt nicht bei der Öffentlichkeit – sondern bei den durch EDMO legitimierten Gatekeepern: Bei Faktencheck-Redaktionen, deren Kriterien selten transparent und häufig ideologisch vorgeprägt sind. Die Plattformen wiederum (Meta, Google) nutzen EDMO-Berichte zur algorithmischen Bewertung – und entscheiden darüber, welche Inhalte viral gehen und welche im digitalen Orkus verschwinden.
EDMO und die Meinungsfreiheit: Zensur ohne Zensor
Die EU betont regelmäßig, dass EDMO keine Inhalte löscht, sondern lediglich „Hilfestellung“ bietet. Das klingt harmlos. Doch in Wirklichkeit ist EDMO Teil eines regulatorischen Schattenapparats, der faktisch Meinungsäußerungen sanktionieren kann – ohne jemals selbst ein Verbot auszusprechen.
Wie das funktioniert?
EDMO-Hubs liefern systematische Bewertungen an Plattformen.
Plattformen nutzen diese für algorithmische Downrankings.
Inhalte verschwinden aus Feeds, werden demonetarisiert oder gelöscht.
Die Verantwortung bleibt unklar: Weder EDMO noch die EU-Kommission noch die Plattform haftet – aber die Wirkung ist eindeutig zensierend.
Dies ist die neue Form postmoderner Zensur: nicht repressiv, sondern diskretiv, nicht durch Verbot, sondern durch Sichtbarkeitsentzug. Eine Zensur, die nicht schreit, sondern flüstert – und dennoch jede Wirkung erzielt.
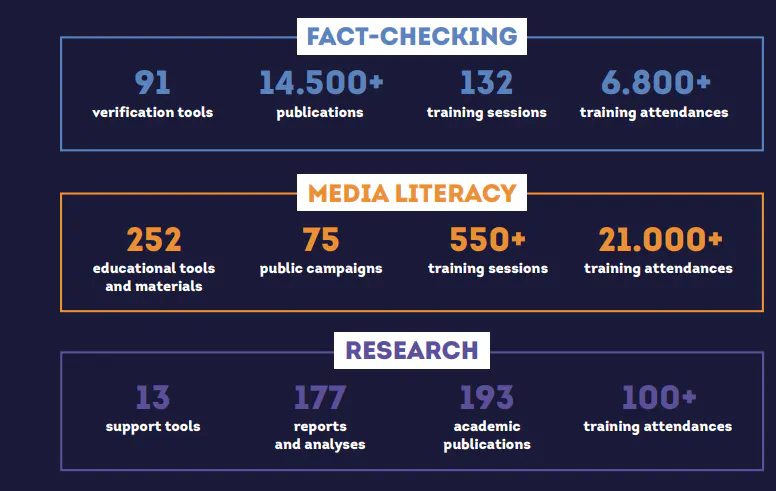
EDMO als Teil des Censorship Industrial Complex
In den USA hat der Begriff „Censorship Industrial Complex“ Eingang in die Debatte gefunden – gemeint ist das Zusammenspiel von Staat, Big Tech, NGOs und Medien bei der Kontrolle des öffentlichen Diskurses. EDMO ist die europäische Entsprechung: ein Projekt, das in enger Abstimmung mit Plattformen, NGOs, Ministerien und internationalen Stiftungen agiert.
Besonders brisant: Auch die Medienkompetenz-Programme von EDMO folgen dieser Logik. Was als „kritisches Denken“ beworben wird, ist oft nicht mehr als die Schulung im Vertrauen auf etablierte Quellen. Kritik wird nicht geübt, sondern geimpft – gegen „abweichende Meinungen“, gegen „alternative Narrative“, gegen jede Form diskursiver Irritation.
Die neue Medienpädagogik zielt nicht auf Mündigkeit, sondern auf Systemverträglichkeit. Ihr Ziel ist nicht Kritik, sondern Konformität mit den Werten der regulatorischen Ordnung.
Wer kontrolliert die Kontrolleure?
Eine zentrale Frage bleibt unbeantwortet: Wer kontrolliert die, die über Wahrheit entscheiden? EDMO erhebt den Anspruch, eine „unabhängige“ Plattform zu sein – doch niemand überprüft ihre Prüfenden. Ihre Partnerorganisationen sind faktisch unreguliert, ihre Standards oft willkürlich. Selbst der Europäische Rechnungshof hält die Strukturen für unausgereift, die Ziele für überambitioniert und die Wirkung für kaum messbar.
Die Wahrheit ist das neue Monopolgut – produziert von Akteuren, die niemand wählt, finanziert von Institutionen, die sich ihrer eigenen Legitimation entziehen.
Die große Gefahr liegt in der Stilllegung des Zweifelns
EDMO ist das Symptom einer größeren Entwicklung: der Transformation der europäischen Öffentlichkeit in eine kuratierte Informationslandschaft, in der Wahrheit nicht mehr das Ergebnis von Streit ist, sondern das Produkt institutioneller Übereinkunft.
Was verloren geht, ist das, was Habermas einmal den „herrschaftsfreien Diskurs“ nannte – oder, moderner formuliert: das offene Feld des Dissens. In einer Zeit, in der politische Kommunikation durch „Vertrauen in Institutionen“ ersetzt wird, ist es unsere Aufgabe, den Zweifel zu kultivieren – nicht als destruktiven Impuls, sondern als Bedingung jeder Demokratie.


