Ego vs. Mitgefühl: Können Eltern zu verständnisvoll sein?
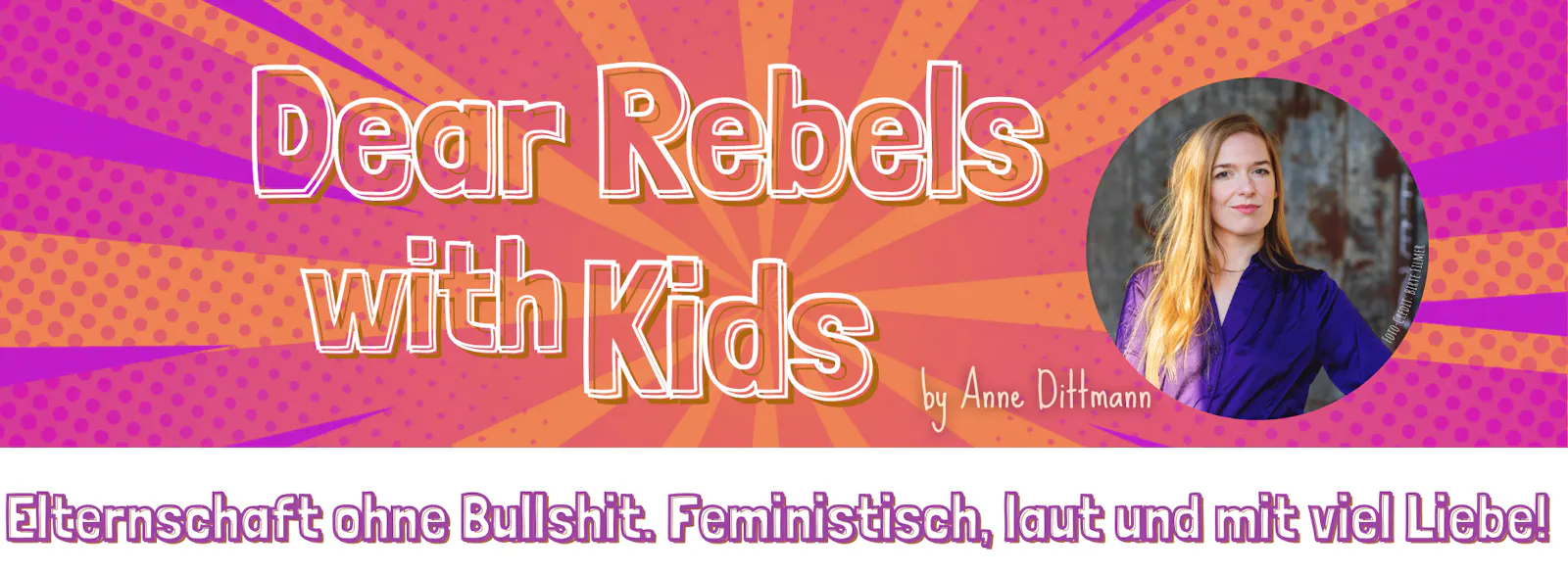
In diesem Longread-Newsletter geht es um die Frage, wie wir Mitgefühl und prosoziales Verhalten bei unseren Kindern fördern können und ob es ein ZU VIEL an Mitgefühl gibt. Und natürlich habe ich dir nicht nur meine Erfahrungen mitgebracht sondern auch ein paar Einblicke in die Forschung und den Input der Expertin Ramona Vetter. (Opens in a new window)

Dear Rebel with Kid(s),
stell dir mal vor, ein älterer Junge schlägt auf dem Fußgängerweg dein Kind ins Gesicht - klar, es weint. Und der Junge? Dreht sich um und will wegrennen. Aber er übersieht die Laterne hinter seinem Rücken, knallt mit der Stirn direkt gegen das Metall, fällt um und weint. Die Mutter des Jungen kommt gerannt und tröstet ihn. Dein Kind hat aufgehört zu weinen, jetzt lacht es sogar. Und du? Wärst du insgeheim schadenfroh? Hast du das Gefühl, der Junge hätte bekommen, was er verdient? Hand aufs Herz: Ich würde vermutlich erstmal eine gewisse Genugtuung verspüren, weil er eben nicht einfach so davon gekommen ist. Aber: Werde ich einem verletzten Kind damit wirklich gerecht? Oder zwei verletzten Kindern?
Ich muss an eine Freundin denken, die kürzlich sagte: “Ich weiß nicht, ob ich mein Kind zu einem fürsorglichen Erwachsenen erziehe oder zu einem Arschloch”. Meine Freundin ist die Sorte Mutter, die niemals ausrastet, niemals schreit, jedes kleine Feuer verständnisvoll löscht. “Manchmal zweifle ich aber daran”, sagte meine Freundin, “ob das Mitgefühl, mit dem ich mein Kind füttere, zu einem Mitgefühl für andere wird oder nur Mitgefühl mit sich selbst”.
Gibt es ein zu viel an Verständnis für das eigene Kind? Das habe ich mich selbst schon in einer Situation auf dem Spielplatz gefragt, als mein Sohn noch kleiner war: Wir steckten in einem Stau - zwei Meter vor dem Eingang zur Rutsche. Was los war: Ein Kind wollte oben auf der Rutsche sitzen und den Ausblick genießen, aber nicht rutschen. Bitten und Drängen halfen nichts. Hinter dem Jungen standen gut zehn Kinder und ich - und wir alle verloren allmählich die Geduld.
 (Opens in a new window)
(Opens in a new window)Dann kam auch schon sein Vater. Ich dachte: “Gut, jetzt wird er den Stau auflösen”, aber er hockte sich nur neben ihn und begann eine Verhandlung darüber, wie lange er noch sitzen bleiben könne, ehe die anderen Kinder - und ich - nun wirklich ein Recht darauf hatten, endlich rutschen zu dürfen. Ich konnte es zwei Minuten später immer noch nicht glauben. “Hallo?! Wir stehen hier und wir haben jedes Recht zu rutschen, das ist für euch gar nicht verhandelbar”, dachte ich. Und sagte: “Könnten Sie nicht Ihr Kind erstmal runternehmen und den Rest woanders besprechen?” - Nein, konnte er nicht, wie er mir daraufhin erklärte, denn das wäre Gewalt.
Haha. Ok. Cool. Fühlt sich für uns anderen voll … gut an … (Nicht.)
Wenn es darum geht, wie wir Mitgefühl und prosoziales Verhalten bei unseren Kindern fördern, spalten sich bei Eltern und Großeltern die Geister. Manche bevorzugen Belohnungen als Mittel der Wahl - dann muss man auch nicht streng sein. Beispiel: Mein Sohn hat kürzlich überraschend zehn Euro von seiner Großmutter bekommen, weil er in einer gemeinsamen Aktion ihren Teich von Algen befreit hat - was ihm by the way großen Spaß gemacht hatte. Und fürs Teilen seiner Süßigkeiten mit einer Freundin bekam er von ihr mehr von den Süßigkeiten geschenkt - beides als Belohnung, um das erwünschte Verhalten zu fördern. Damit er merkt: Freundlichkeit zahlt sich aus.
Aber jetzt mal Fakten auf den Tisch: Was sagt die Wissenschaft zu all dem? Wie fördern wir Verständnis, das Bedürfnis zu helfen, die Fähigkeit zu trösten bei unseren Kindern wirklich? Indem wir es vorleben? Über Belohnungen? Oder ganz anders?
Nicht vergessen: Wenn dir der Newsletter gefällt, dann zeige es mir doch gerne, indem du mich supportest <3 Teile den Newsletter mit anderen oder schließe eine Mitgliedschaft ab.
Ich habe mir einige verschiedene Arbeiten angesehen. Falls du nachlesen magst: Die Doktorarbeit (Opens in a new window) der promovierten Sozialwissenschaftlerin Sylvia Huber, betreut von Dieter Ulrich, Leiter der Forschungsstelle für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie an der Universität Augsburg, wirft einen umfassenden Blick auf den Forschungsstand.
Alter? Genetik? Erziehung? Was uns emapthisch macht
Um diesen Beitrag lesen zu können, musst du Mitglied werden. Mitglieder helfen uns, unsere Arbeit zu finanzieren, damit wir langfristig bestehen bleiben können.
Zu unseren Paketen (Opens in a new window)
Already a member? Log in (Opens in a new window)


