Gorffennaf: Nobody ever mentions the weather
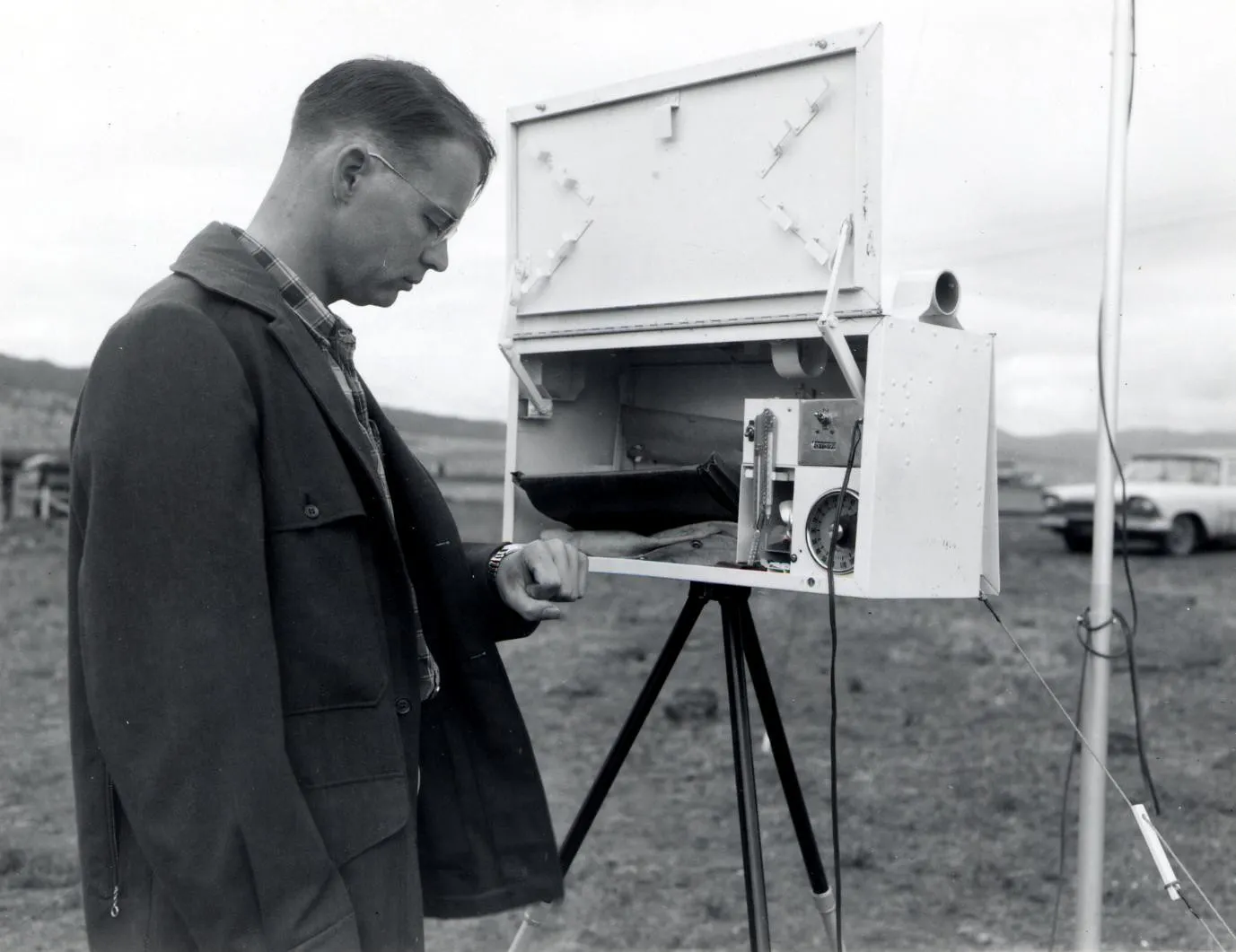
Alle reden vom Wetter! So billig muss man einen August-Newsletter erst einmal anfangen, direkt einsteigen mit der schlechtestgealterten Werbeanzeige (Opens in a new window) der Geschichte der Bundesrepublik. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sich dieser Sommer eine kurze Weile von seiner unangenehmsten Seite gezeigt hat, als es in weiten Teilen des Landes fast 40 Grad im Schatten hatte (und es danach wochenlang regnete) und die Hitze der Bürgersteige zumindest durch meine dünngelaufenen Plastikschuhsohlen zog. Nun sind drei Tage Hitze erst einmal Wetter, aber viel Wetter wird Klima, und das Klima hat sich in den letzten Jahren so stark geändert, dass dieser Wandel eigentlich nicht mehr abstreitbar sein sollte.
Sollte, klar. Aber eine nicht kleine Gruppe von Menschen hört nicht auf, der Realität Widerstand zu leisten. Das kennen wir schon von Pandemien, Umfrageergebnissen und Feinstaubbelastungen, aber tatsächlich scheint die Gruppe, was Wetterbeobachtungen angeht, deutlich größer zu sein. Das liegt natürlich oft an politischen Überzeugungen, am Unwillen, die Rolle des Kohlendioxid-Anteils in der Luft für unser globales Klima anzuerkennen und konkrete politische und persönliche Schlüsse daraus zu ziehen: Weniger zu fliegen, weniger Auto zu fahren, weniger Beton zu gießen und so weiter. Aber es muss nicht daran liegen, wenn Leute behaupten, wir hätten auch früher schon Sommer mit 40 Grad gehabt und man würde sich heute nur so anstellen, weil „DIE_MEDIEN“ das so behaupten.
Tatsächlich ist Erinnerung eine sehr trügerische Sache, das lernen wir Historiker:innen leider zu selten in unseren Seminaren und zu oft erst in konkreter Forschungsarbeit mit Leuten, die sich eben erinnern. Unsere erste Reaktion auf diese Erfahrung ist meist, die Motivation kritisch zu hinterfragen (was eine gute Idee ist) und dann sinistre Motive von Geschichtsfälschung zu vermuten (was keine sonderlich gute Idee ist). Natürlich gibt es das, die Autobiografie von Albert Speer ist genau so ein Beispiel, wo es jemand geschafft hat, der Lieblingsnazi der Nachkriegsdeutschen zu werden. Aber in den meisten Fällen erinnern sich die Menschen schlicht falsch, weil Erinnerung nachlässt und Leerstellen von unseren Hirnen in der Gegenwart aufgefüllt wird – und in der stellen sich Dinge anders da, haben wir andere Werte und Ansichten. Und natürlich möchten wir alle gemocht werden.
Und damit kommen wir wieder zu den Hitzetagen. On- wie offline entspannen sich Debatten darüber, ob das nun normale heiße Sommertage seien, die wir immer schon hatten. Interessanterweise wurde dabei immer mal wieder Rudi Carrells Gassenhauer (welch ein schönes Wort) „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ als Argument herausgeholt, ein Lied von 1975, dessen Zeile „Mit Sonnenschein von Juni bis September“ Beleg genug dafür sein sollte, dass es auch damals schon eine Jahreszeit über nicht geregnet habe. Das fand ich insofern bemerkenswert, dass das Lied ja eigentlich vom Quellenwert her genau das Gegenteil aussagt: Dass es nämlich zumindest in den 1970er Jahren eben nicht dauerhaft sonnig und heiß gewesen sei, aber das Sänger-Ich sich zumindest daran erinnere, dass es mal so gewesen sei.
Nun haben wir die Möglichkeit, Wetterdaten nachzuvollziehen und können entsprechend mit wenigen Klicks herausfinden, dass am Samstag, den 12. April 1975, als Rudi Carrell das Lied erstmals im Fernsehen sang, die Höchsttemperatur in Deutschland 10 Grad Celsius betrug, und zwar entlang des Mittelrheins und in Stendal – im Erzgebirge erreichte das Thermometer an diesem Tag nicht einmal Plusgrade. Wir sehen auch, dass zum Höhepunkt des Sommers (wir nehmen einfach mal die Mitte des „von Juni bis September“ als den 1. August an) die hochsommerlichen Temperaturen zum Maximum von 31 Grad führten, in Südbaden entlang des Oberrheins.
Aber das eigentliche Motiv des Liedes ist ja die Nostalgie, und Nostalgie betrifft oft hauptsächlich die Jugend. Gehen wir daher von dem Sommer aus, in dem Rudi Carrell 15 Jahre alt war, betrug die Höchsttemperatur am 1. August 29 Grad, an der niederländischen Grenze gar nur 20. Die höchste überhaupt im Sommer 1950 in Deutschland gemessene Temperatur lag, für genau einen Tag, bei 33 Grad in Freiburg im Breisgau (Opens in a new window).
Nun ist es müßig, euch Leserinnen vorzubeten, dass es früher nicht so warm war, wie es jetzt mitunter ist. Die wenigsten von euch müssen davon überzeugt werden. Mir geht es um etwas anderes: Die Ablehnung von Fakten, obwohl sie leicht und frei zugänglich im Internet verfügbar sind. Denn auf Kachelmannwetter zu gehen und sich dort die historischen Wetterdaten anzugucken, das kann letztlich jeder. Zahlen auf einer Deutschlandkarte interpretieren wäre jedem zuzumuten. Es ist, wie man hier unten sagt, kein Hexenwerk.
Nun ist in den von mir geführten Diskussionen aber etwas durchaus Interessantes passiert: Die Menschen haben sich nicht umstimmen lassen – das war erwartbar. Aber noch mehr war zu beobachten, nämlich die Ablehnung der vorgebrachten historischen Fakten (nun schreien manche Postmodernitäter, Fakten seien doch ohnehin eine Illusion, aber nehmen wir mal Messdaten als Fakt an). Die Überzeugung, dass es auch früher laufend Tage mit an die 40 Grad Hitze gegeben hätte, ja über Wochen und Monate, erwies sich als stärker als die übereinstimmenden Datenbanken. Ja noch mehr: Auch bei durchaus wohlmeinenden Personen ergab sich daraus die logische Folge, dass nicht das eigene Gedächtnis falsch liegen würde, es musste Jörg Kachelmann oder der Deutsche Wetterdienst oder wer auch immer sein, der da mit großem Aufwand über das historische Wetter log.
Da kam mir der Gedanke, und man verzeihe mir, wenn der nicht sonderlich kreativ ist: Vielleicht ist nicht ein Zuwenig an Information schuld an der Krise von Demokratie, Glaubwürdigkeit, Faktizität und dem ganzen anderen Kladderadatsch, sondern ein Zuviel: Stritt man früher über Dinge, dann war man gezwungen irgendwann gemeinsamen Grund zu finden oder wenigstens friedlich auseinanderzugehen, im jeweiligen festen Wissen richtig gelegen zu haben. Heute allerdings lässt sich eine ungeheure Menge an Fakten, Daten, Argumenten und Übersichtsdarstellungen jederzeit und fast überall auf der Welt abrufen, und das muss bei inhaltlichen Streitigkeiten fast unweigerlich dazu führen, dass eine Seite inhaltlich unterlegen ist, weil ihre Überzeugung der kursorischen Überprüfung nicht standhält. Nun sind wir Menschen aber nicht so gestrickt, dass wir solche liebgewonnenen Standpunkte einfach über Bord werfen, und die einfachste Möglichkeit beim eigenen Standpunkt zu bleiben ist, die Fakten abzulehnen. Oder konkret: Dadurch, dass die historischen Wetterdaten bei Kachelmannwetter jederzeit aufrufbar sind, werden sie für manche zum Teil der großen Lüge.
Das ist der aktuelle Stand. Und jetzt stelle man sich vor, die Menschen benutzen statt Google in Zukunft den „KI“-Chatbot ihrer Wahl. Es liegt nahe, dass Klimawandelleugnerinnen, Rechtsextreme und Impfgegner sich eher an Elon Musks digitalen Chefideologen Grok wenden werden. Der wird ihnen größtenteils nach dem Mund reden. Und schon werden sie ihm eher vertrauen als den bösen anderen Quellen, die man evtl. noch selbst lesen muss, und die einem widersprechen. Interessante Zeiten!
Um mal etwas banaler zu werden: Der beginnende Sommer war auch die Zeit der ersten Oasis-Tournee seit sechzehn Jahren, und ich war einer von zehntausenden Menschen, die einem Mittvierziger mit breitem walisischem Akzent auf TikTok beim ersten Konzert aus Cardiff zusahen, inklusive eines kurzen, glücklicherweise sehr dezent inszenierten Toilettengangs kurz vor Konzertbeginn. Musik- wie Gesellschaftspresse haben ausführlich genug über das Erlebnis gesprochen, aber tatsächlich ist mir da wieder aufgefallen, welch enorm beglückendes Momentum solche Massenveranstaltungen haben können, wenn sie sich aus einem positiven Erlebnis speisen – sehen wir einmal von der letzten Tour von Taylor Swift ab, kennen wir ja Großereignisse mit zehntausenden Menschen, die sich geeint in einer Sache sehen, gerade hauptsächlich aus unangenehmen populistischen wie eskalationsbereiten Sphären. Man kann von Oasis halten, was man will (solange man akzeptiert, dass es die größte Band der 1990er Jahre war), aber dass zehntausende Menschen pures Glück in zwei Stunden empfinden, die mit dem Satz „We put this festival on for you bastards“ begonnen haben, das ist schon etwas Besonderes. Anja Rützel hat das erklärt (Opens in a new window) mit der Möglichkeit für Männer, mal wieder positiv Männer sein zu können, aber ich glaube darüber hinaus geht es auch um weniger geschlechter- als menschenspezifische Dinge: Wir alle müssten viel öfter gemeinsam singen.


