Von Rastignac bis Benko, Kurz und Donald Trump.
Vor 175 Jahren starb Honoré de Balzac. Wie das Geld die Beziehungen ruiniert, wie es in der Welt der Wichtigtuer und Dealmaker zugeht – das beschrieb er bis heute unübertroffen.
Wenn ihr die Texte hier regelmäßig in Eurem Posteingang haben wollt, würde es mich freuen, wenn ihr sie abonniert. Und wenn sie Euch gefallen, bitte weiter schicken, teilen, posten etc. Und natürlich könnt Ihr sie auch mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag unterstützen.
DAS GROSSE BEGINNERGEFÜHL. Am 18. August vor 175 Jahren starb Honoré de Balzac. Hier ein leicht gekürztes Kapitel aus meinem Buch „Das Große Beginnergefühl. Moderne, Zeitgeist, Revolution“, das vor zwei Jahren im Suhrkamp-Verlag erschienen ist. Entlang großer Kapitel über Heinrich Heine, Karl Marx, die Dadaisten, Baudelaire, Picasso, Giacometti, Duchamp bis Susan Sontag, Sylvia Plath, Elfriede Jelinek und Milo Rau uva. wird darin das Wechselspiel von Zeitgeist, Avantgarde und politischem Radikalismus als umfassende Geschichte der modernen Kunst erzählt. Falls Du es noch nicht hast: Gleich bestellen oder in der Buchhandlung deines Vertrauens besorgen!
Alles dreht sich um das Geld. Es ist eine gängige, konventionelle Auffassung, dass die Gier nach Geld alles zur Ware macht und dazu führt, dass nur das Geld mehr zählt, dass alle tieferen sozialen Bande zerreißen und in Berechnung aufgelöst werden. Dass irgendwie das »Wahre«, das »Echte« verlorengeht. Oft ist das nur eine kulturpessimistische Pose, die an den Oberflächen der Phänomene hängen bleibt, und doch zugleich Ausdruck davon, dass viele Menschen das Gefühl haben, »irgendetwas« an unserer Gesellschaftsform würde doch ganz offensichtlich nicht stimmen. Mehr »Unbehagen« als messerscharfe kritische Analyse.
Es gibt ganz allgemein seit jeher zwei Kritiken am Kapitalismus. Erstens die ökonomische Kritik, dass er ungerecht ist, und zweitens das kulturkritische Lamento, dass die allumfassende Geldwirtschaft, die Zersetzung aller sozialen Bande, die Reduktion aller Beziehungen auf Eigennutz und die kalte Kalkulation die Menschen von sich und voneinander entfremde, dass in einer solchen Welt nur zählt, was sich rechnet.
Eine Kritik oder nur eine Gesellschaftsanalyse der bürgerlichen Welt, wie sie sich spätestens ab dem 19. Jahrhundert durchsetzte, musste ganz schnell beim Geld landen. »Es ist die wahre Scheidemünze, wie das wahre Bindungsmittel, die chemische Kraft der Gesellschaft. […] Es ist die allgemeine Hure, der allgemeine Kuppler der Menschen und Völker«, formulierte kraftvoll der junge Karl Marx in seinen legendären »Pariser Manuskripten« von 1844. »Es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Haß, den Haß in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn.« Bald ging die große marxsche Gesellschaftsanalyse in eine umfassende Kritik über, wie Geld sich in Kapital verwandelt und zu »geldheckendem«, sich vermehrendem Geld wird, zu Vermögen im Verwertungsprozess, und wie all das aber auch in Machtstrukturen verfestigt wird und sich sogleich in Ideologie und Bewusstseinsformen übersetzt. Das Wirtschaftsbürgertum wird zur neuen konservativen Klasse, mit erbärmlicher Kleingeisterei und starkem Hang zum Konventionellen.
Schon zu Beginn dieser Entwicklung hat Honoré de Balzac (1799-1850) dieses Großpanorama der neuen Gesellschaft in die Literatur eingeführt. Balzac hat, wie Stefan Zweig später notierte, »das Geld in den Roman gebracht«. Was Balzac in seinen Werken beschrieb, war die Welt ab etwa 1820, also das Frankreich der monarchischen Restauration, in dem sich hinter der Fassade des Gestrigen mit der Gewalt einer tektonischen Verschiebung das Neue durchzusetzen begann. Die Aristokratie brauchte das Geld der bürgerlichen Geschäftswelt, die bürgerliche Geschäftswelt den Glanz der statushöheren Adelsfamilien. Die Künstler verachteten die Geldwelt, lebten aber von deren Kapital. In Balzacs Menschlicher Komödie ist Geld »der Lebenssaft der Gesellschaft« (Peter Brooks).
Ansehen konnte man kaufen, Geld durch Statusprunkereien erwerben. Man musste die neue Welt zu lesen lernen. »Die Voraussetzung für Erfolg war, dass man lernte, die subtilen Abgrenzungen von Klasse und deren Bedeutungen zu lesen«, schreibt Peter Brooks in Balzac’s Lives über die »Semiotik« des modernen, städtischen Lebens, das wie ein ganz eigenes Zeichensystem funktionierte. Geldleute stiegen auf, Aristokraten stiegen ab, junge Männer kämpften um ihr Glück, junge Frauen waren unglücklich, weil ihr Leben nicht das hielt, was es versprochen hatte. Kleine Geschäftsleute wurden aufs Kreuz gelegt und in den Ruin getrieben, große Fische fraßen die kleinen, und die normalen, einfachen Leute kämpften um das tägliche Überleben, gelegentlich rebellierten sie, oft machten sie einfach einen Knicks, denn man muss sich andienen und die Selbstachtung in der Umkleidekabine abgeben, wenn man überleben will. Balzacs Stunde war, wie Adorno das später nannte, eine von »ursprünglicher Akkumulation, altertümlicher Conquistadorenwildheit inmitten der französischen industriellen Revolution des früheren neunzehnten Jahrhunderts«.
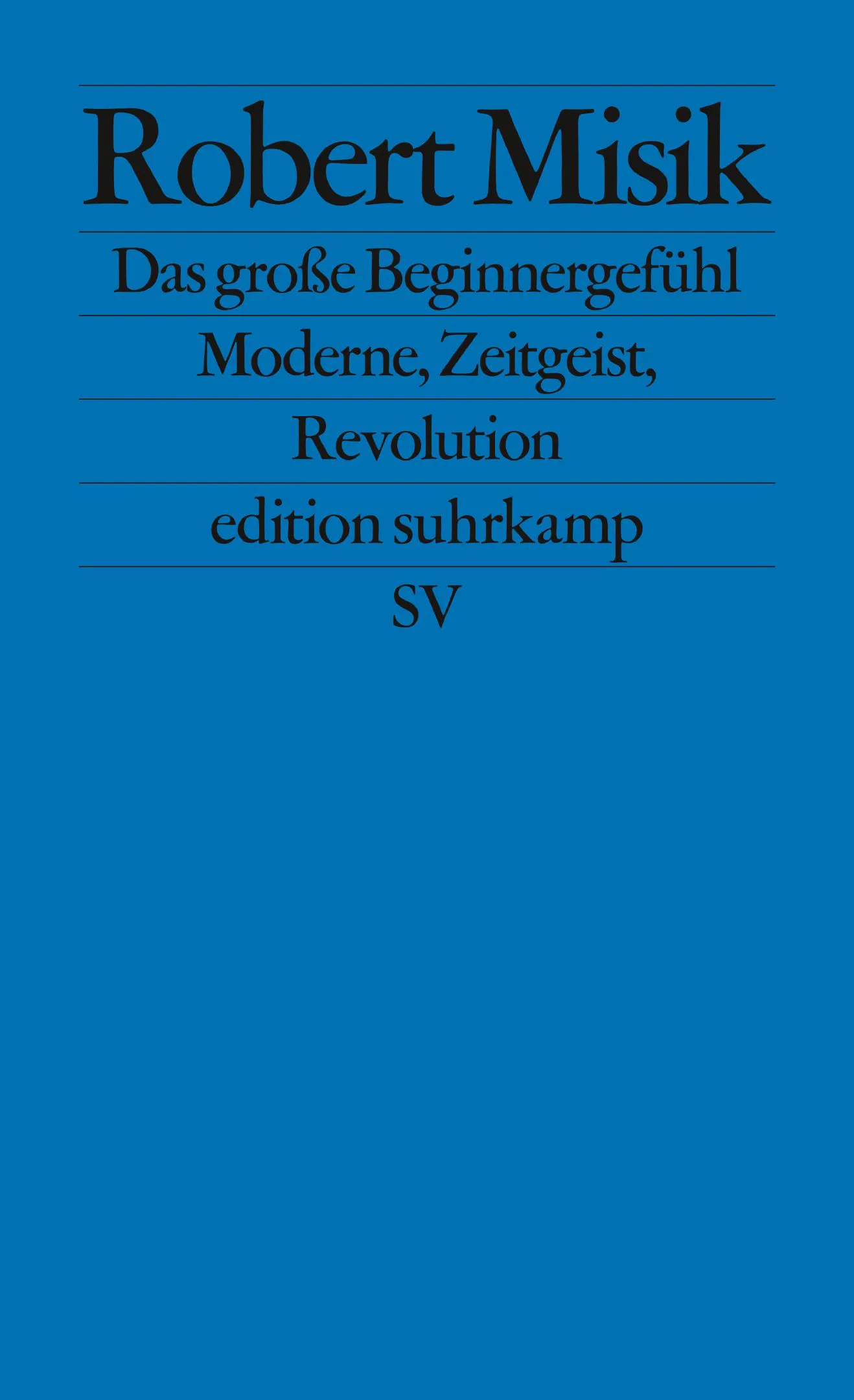
In der Restaurationsepoche läuft dieser gesellschaftliche Wandel an, nach der Julirevolution von 1830 und der Machtübernahme des »Bürgerkönigs« Louis-Philippe I. beschleunigt er sich. Aber es war auch ein Hin und Her der Atmosphären, von Aufbruchstimmung und Enttäuschung, von Revolution, Restauration und Konterrevolution. Und zwar in ganz Kontinentaleuropa, von der Art verallgemeinerter Trends, eines Zeitgeistes, der nicht an nationalen Grenzen Halt machte – der, kurzum, von regionalen Sonderwegen beeinflusst sein mochte, aber nicht zu sehr.
Honoré de Balzac verarbeitete diese neue Zeit mit unerhörter Produktivität in seinem Großpanorama, einem gigantischen Romanwerk. Er schrieb schnell, in Hast, jede Nacht, saß bis frühmorgens in seiner Mönchskutte am Schreibtisch, bei Kerzenlicht und mit Kannen voll Kaffee, lieferte Fortsetzungsromane, schrieb sie um, montierte sie zum zusammenhängenden Opus der Comédie Humaine, der Menschlichen Komödie, im Endausbau rund neunzig Romane und Erzählungen. Als Kind eines Bauernsohnes und einer Tochter aus großbürgerlicher Familie geboren, erschwindelte er sich das aristokratische »de«, war vom Hunger erfüllt, im feudaladeligen Milieu Anerkennung zu finden, also genau jenen Aufstieg zu schaffen – am besten durch Liaisons und eine gute Heirat –, wie er sie in seinen Romanen beschrieb. Politisch war er eindeutig eher Reaktionär und Royalist als Demokrat, Sozialist oder Revolutionär und grundlegend verwirrt. Magnetisch zogen ihn die Salons und Bälle der besseren Kreise an, seine Gesellschaftsstudien legte er, wie man heute sagen würde, auf die Art des »teilnehmenden Beobachters« an. Bevor er das Wagnis der freien Schriftstellerei einging, machte Balzac eine zweieinhalbjährige juristische Ausbildung, in der er nützliche Fachkenntnisse erwarb, vor allem aber viel Anschauung an »menschlicher Niedertracht, Falschheit, Raffgier und Verlogenheit«. Er wusste, wie man Geschäfte aufsetzt, die das Verbrechen legalisieren, er kannte die Tricks, mit denen man andere aufs Kreuz legen kann, und die kriminelle Ruchlosigkeit hinter den Fassaden der Rechtschaffenheit. Ihm war klar, dass man nicht nur in Deals im engeren Sinne investieren musste, sondern auch in »Freundschaften, Vergnügungen, Beziehungen und Bekanntschaften«. Die Welt der Aufsteiger und Erfolgsmenschen ist eine Bussi-Bussi-Gesellschaft, in der alles eingefärbt ist vom Geld, die Beziehungen ebenso wie der statusbedachte persönliche Stil, der einerseits Geld kostet, andererseits aber notwendige Vorbedingung ist, um überhaupt an den Geschäftstisch vorgelassen zu werden. Selbst ein Bruder Lustig, kam Balzac in den Klatschspalten seiner Zeit vor, war ein Genie der Selbstreklame, seine Romanmanufaktur hatte »etwas Fabrikmäßiges«, und selbst pflegte er einen Lebensstil, der seine materiellen Möglichkeiten dramatisch überstieg. Was für die Nachwelt freilich den Vorteil hatte, dass er gehetzt Werk um Werk produzieren musste, damit er die Schulden bedienen konnte, die ihm über den Kopf wuchsen.
2472 Personen haben in Balzacs Menschlichen Komödie ihren Auftritt, damit kann man problemlos das Telefonbuch einer Kleinstadt füllen. Noch der letzte, kleinste seiner Charaktere hat ein ganzes Leben, ist eine reale Figur, nicht bloß eine schnell skizzierte Karikatur. Manche kommen nur einmal vor, andere treten in vielen seiner Romane auf, wir verfolgen sozusagen ihre ganze Biografie. Da ist etwa Eugène de Rastignac, eine der am häufigsten auftauchenden Figuren des Zyklus. Ein Baron aus verarmtem Haus, aber mit Verbindungen, kommt er als junger Mann nach Paris, seine ersten Aufstiegsmonate stehen in Zentrum des Romans Vater Goriot (1835). Noch hat er moralische Grundhaltungen, die er allerdings schnell ablegt, weil sie seinem Ehrgeiz im Wege stehen würden. Aber wie es eine Eigenart des Menschen ist, entledigt er sich ihrer nicht sofort, er wird nicht einfach zynisch, sondern es sind die Umstände, die ihn allmählich ummontieren. Marx wird später formulieren, dass das menschliche Wesen kein dem Individuum innewohnendes Abstraktum, der »Mensch« vielmehr das »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« sei. Rastignac ist, wie er ist, weil die Verhältnisse sind, wie sie sind. Die verdichtete Charakterfigur ist so weit in die französische Alltagssprache hinabgesickert, dass ein juveniler, skrupelloser, ehrgeiziger, oberflächlicher Aufsteiger – also das Durchschnittspersonal der Geschäftswelt bis zum heutigen Tage – als »Rastignac« bezeichnet wird. Rastignac begegnet schon in den ersten Tagen in Paris einigen Frauen, deren Schönheit, Charme, Beziehungen und Vermögen ihn anziehen, aber wie die Dinge liegen, macht Vermögen dann die Frauen in seinen Augen noch schöner, noch charmanter, gewiss noch begehrenswerter. Also: Er entscheidet sich nicht für das Vermögen und gegen die Liebenswürdigkeit, die Dinge sind ja durchaus subtiler, das Vermögen lässt die Liebenswürdigkeit noch klarer strahlen, während die Aussicht auf ein Leben mit wenig Geld auf die Liebenswürdigkeit beträchtliche Schatten wirft. Auch die Berechnung produziert echte Gefühle. Die Liebe ist von der Gier selbst für den Liebenden nicht immer trennscharf zu unterscheiden. Die Liebe spielt überhaupt bei Balzac eine große Rolle, wird vom Geld aber unmöglich gemacht: Wer berechnend liebt, zerstört die Liebe, wer hingebungsvoll liebt, stürzt gerade deswegen in den Bankrott.
Wem alles zufliegt, dem fliegt noch mehr zu. »Es gibt Menschen«, schreibt Balzac in Verlorene Illusionen (1836-43), denen
alles erlaubt ist: Sie können die unvernünftigsten Dinge machen, ihnen steht alles an; alle beeifern sich, ihre Handlungen zu rechtfertigen. Aber es gibt andere, gegen die die Welt unglaublich streng ist: Sie müssen alles recht machen, dürfen sich nie täuschen, nie einen Fehler machen, nicht einmal eine Dummheit begehen.
Hauptfigur in diesem vielleicht berühmtesten, modernsten und wegweisendsten der balzacschen Romane ist Lucien Chardon beziehungsweise Lucien de Rubempré, der verlorene Adelstitel rührt von mütterlichen Vorfahren her. Lucien lebt in der Provinz, ist ein junger Dichter von mäßigem Talent, das immerhin ausreicht, um vor der rustikalen Aristokratie der Kleinstadt zu glänzen. Er geht eine Liebschaft mit einer Dame aus der Oberschicht ein, mit der er nach Paris zieht, voller Hoffnung auf gesellschaftlichen Aufstieg. Ohne Geld gerät er in das Milieu der künstlerischen Bohème, auch der ernsthaften Geisteswelt, die Kreise der Blender und Geschäftemacher. Geld regiert alles, auch die Literatur ist ein Geschäft, und Zeitungen erst recht. Lucien ist zuerst unbeholfen am hauptstädtischen Parkett, lernt aber unglaublich schnell das Gewusst-Wie, das comme il faut. Dabei wird zugleich der Schleier großer Ideen und moralischer Bekundungen weggerissen, und übrig bleibt nur die Lächerlichkeit der Existenzen, die Käuflichkeit von allem und jedem. »Muss man seine ganze Würde aufgeben?«, fragt er sich. Es sind diese balzacschen Sätze: »Er war aufs höchste verblüfft über diese Kriecherei«. Und: »Ach, lieber Freund, Sie haben noch Illusionen.« Oder: »Er ist dankbar aus Berechnung. Das ist die beste und solideste Dankbarkeit.« Lucien glänzt zeitweise als Zeitungsmann in der neuen bürgerlichen Welt des Ideenjournalismus, aber schon übt Balzac eine beißende Kritik an der Presse, wie wir sie später etwa bei Karl Kraus wieder finden werden: »Die Zeitung […] ist aus einem Mittel ein Geschäft geworden; und wie alle Geschäftsunternehmungen ist sie ohne Treu und ohne Ehrlichkeit.« Dem Publikum werden nur die Worte verkauft, »die es haben will […]. Eine Zeitung ist nicht mehr dazu da, die Meinungen zu klären, sondern ihnen zu schmeicheln. Daher werden alle Zeitungen nach einiger Zeit erbärmlich, heuchlerisch, infam, lügnerisch, mörderisch sein.«
Balzac zeigt die ganze Brutalität der angeblichen Rechtschaffenheit, die das nackte Recht des Stärkeren hinter Paragrafen verschleiert. So beschreibt er etwa, wie ein kleiner Druckereibesitzer (der Schwager Luciens) von großen Konkurrenten und schmierigen Advokaten um seinen Besitz und seine Erfindung gebracht wird: »[Z]u was für wunderbaren Späßen ein Paragraph des Handelsgesetzbuches die Möglichkeit gibt; diese Auseinandersetzung mag zeigen, wieviel Entsetzliches unter dem schrecklichen Wort ›Gesetzlichkeit‹ verborgen ist.«
Balzac zeigt von Roman zu Roman einen immer breiteren Querschnitt der zeitgenössischen Gesellschaft. Ihren Auftritt haben die Unter- und Gaunerwelt, die kleinen Leute, die Dirnen, die aufstrebende Hochfinanz, junge Männer, die es schaffen wollen, Scheiternde ohne Energie, Figuren der Intensität. König, Adel, Oberschicht, Polizei, Staatsapparat, und all das steht stets auf tönernen Füßen, wird untergraben vom gesellschaftlichen Wandel, auf den Kopf gestellt durch die andauernden Regimewechsel, an die sich die Akteure geschmeidig anpassen müssen, Wendehälse allesamt. Schleimer, die wittern, wohin das Pendel als Nächstes schwingt. Ein »Hexenkessel von Gestalten« (Stefan Zweig). Alle versuchen festen Stand zu behalten oder zu ergattern in einer Welt, in der nichts mehr stabil ist.
In Glanz und Elend der Kurtisanen (1839-47) hat Jacques Collin, eine Art König der Verbrecher, einen seiner vielen Auftritte, und Balzac arbeitet heraus, dass Habitus und Stil der besseren Schichten auch nur Regeln und Gewohnheiten sind, die sich von denen der Verbrecher nicht unterscheiden. »Man sieht, dass sich in allen Schichten der Gesellschaft die Bräuche gleichen und nur in der Art und Weise und in Nuancen verschieden sind. Auch die große Welt hat ihr Rotwelsch, aber dieses Rotwelsch heißt ›Stil‹.« Könige, Banker und Verbrecher, das sind, nüchtern betrachtet, nur unterschiedliche Positionen am großen Brettspiel der Gesellschaft, Positionen in einem Stellungskampf, die moralisch gleich viel wert sind.
Die Gesellschaft selbst sei der Geschichtsschreiber, er nur »ihr Sekretär«, der die Inventur der Laster und Tugenden aufnehme, schrieb Balzac. Als Royalist, Konservativer und Reaktionär war er gewiss kein Revolutionär von der Intention her, doch die Gesellschaftskritik ist ihm natürlich nicht einfach »passiert« – dazu ist sie zu scharf, zu klarsichtig, zu gnadenlos. Mit Balzac kommt die Stilrevolution des »bürgerlichen Romans« zu ihrem ersten Höhepunkt, eine Kunstform, die kaum mehr Anleihen beim Märchenhaften und beim übertrieben Ausgedachten braucht. Der »Realismus« widmet sich der realen Welt bis in die letzten Details. Charaktere sind realistisch, dabei aber zugleich verdichtet, zu Typen, zu dem, was Marx später »Charaktermasken« nennen wird. Realismus heißt aber genau nicht, sich nur auf die erkennbaren, äußerlich beschreibbaren Phänomene der Wirklichkeit zu konzentrieren, sondern exakt herauszuarbeiten, was die Individuen im Inneren antreibt. Das realistische ist das psychologisch feinfühlige Erzählen. Geld, Macht, die subtilen Fäden, die Menschen miteinander verbinden, die komplizierten und feinen Beziehungen, die Einzelne und das gesellschaftliche System verweben, ihre Werthaltungen, die sie sich zurechtlegen, Werthaltungen, die nicht viel mehr sind als ein Echo vorherrschender Ideologien und allgemein anerkannter Postulate.
Dieser Realismus stellt sich der Wirklichkeit und ist dabei schonungslos. Damit ist er implizit kritisch und hat einen gesellschaftsverändernden Überschuss, da er gar nicht anders kann, als den Finger in die Wunden zu legen, wie man so gerne sagt. Er ist der Diagnostiker einer kranken Welt. Er malt das »Big Picture«, er produziert gleichsam Gesellschaftstheorie im Vorübergehen. Ökonomie, Gefühle, Psychologie, alles hängt miteinander zusammen, weshalb Marx und Engels ja später bekunden, von Balzac so viel gelernt zu haben.
Auch ihr kritisches Unternehmen war der Versuch einer umfassenden Gesellschaftstheorie, wenn man so will, »totale Theorie«, inspiriert von der balzacschen Methode. Marx’ und Engels’ »systematischer Zugang zur menschlichen Geschichte ist von einem balzacschen Widerhall getragen«. Marx wird 1854 über den literarischen Realismus sagen, dessen Protagonisten vermittelten der Welt »mehr politische und soziale Wahrheiten […] als alle Berufspolitiker, Publizisten und Moralisten zusammengenommen von sich gegeben haben«. Engels wird die scharfe Satire, die bittere Ironie lobpreisen, mit der Balzac die bürgerliche Welt mit ihren »vulgären, reichen Emporkömmling[en]« aufspießte oder ihr Hörner aufsetzte wie die Bürgersfrauen ihren Gatten.
All das macht Balzac zu dem zentralen Wegbereiter einer antibourgeoisen Ästhetik, aber auch neuer literarischer Stile, und zur Quelle des Rohmaterials für vielerlei Kritik an gesellschaftlichen Pathologien. Noch in Thomas Pikettys grandiosem Opus Magnum Das Kapital im 21. Jahrhundert kommen die balzacschen Figuren auf vielen Seiten vor, ein Unterkapitel trägt sogar den Titel »Rastignacs Dilemma«. Der junge, aufstiegsorientierte Baron habe erkannt, so Piketty, was auch heute wieder gilt: Zu echtem Reichtum kann man nur kommen, wenn man sich qua Heirat mit ererbtem Reichtum verbindet, und nicht mit Bildung, Kompetenz, Fleiß und harter Arbeit. Insofern leben wir wieder in einer Welt des Räuberbaron-Kapitalismus und des Neofeudalismus.


