Die Richterin der richtigen Haltung
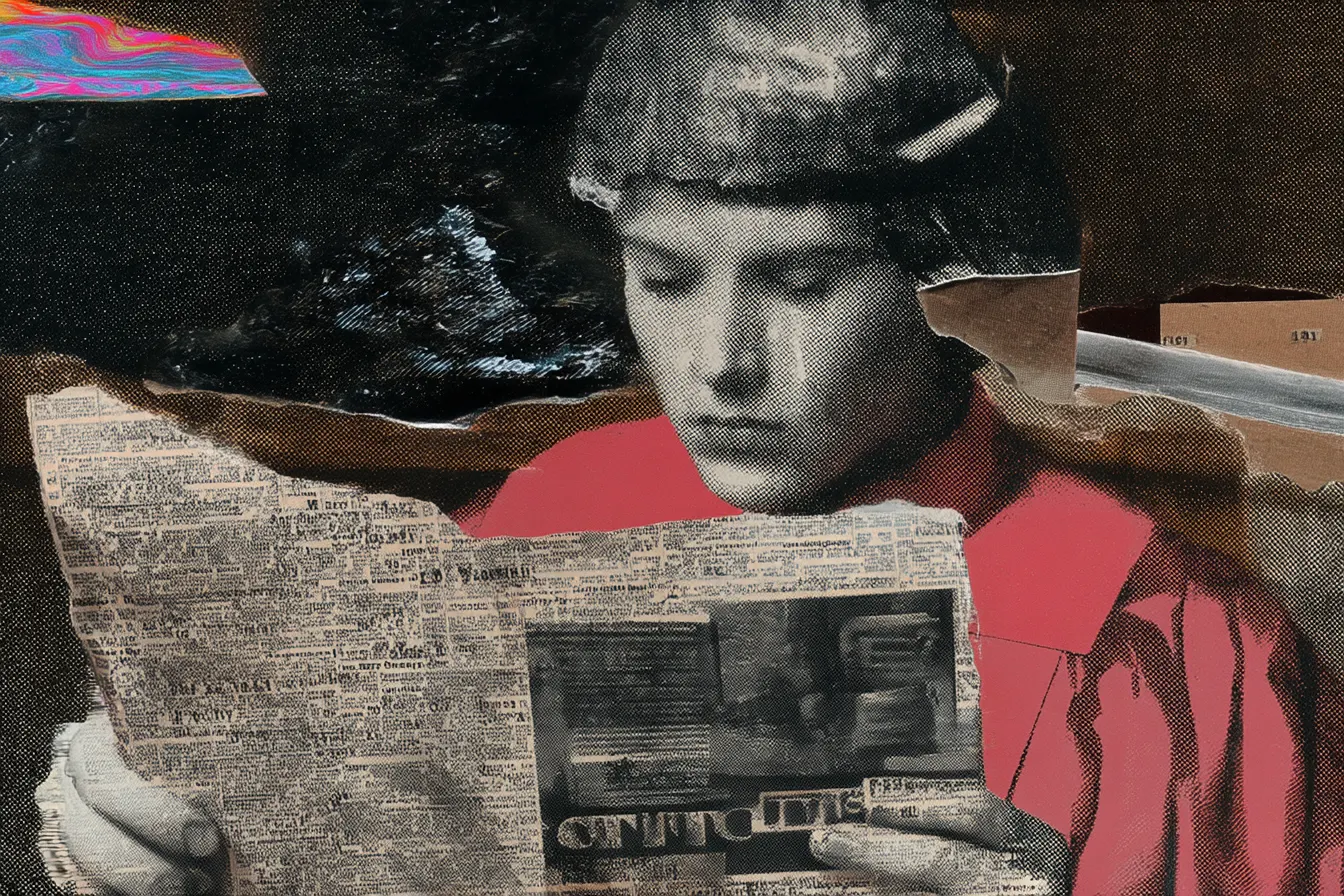
Es gibt Entscheidungen, die scheinen korrekt im Verfahren, logisch in der Parteitaktik, erklärbar in der institutionellen Ordnung – und sind doch in ihrem tiefsten Wesen falsch. Die Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht ist eine solche Entscheidung. Sie steht exemplarisch für eine Transformation der politischen Kultur, die sich nicht mehr in der Repräsentation von Konflikten erschöpft, sondern zunehmend in deren moralischer Auflösung.
Man hat sich daran gewöhnt, dass Spitzenämter nicht mehr durch überparteiliche Autorität besetzt werden, sondern durch „Haltung“. Was früher durch Zurückhaltung glänzte, gilt heute als verdächtig. Und so gelangt eine Juristin ins höchste deutsche Gericht, die weniger durch ihre juristische Integrität als durch eine frappierende Bereitschaft zur politischen Positionierung aufgefallen ist.
Die Aufweichung der richterlichen Neutralität
Brosius-Gersdorf ist keine Unbekannte im rechtswissenschaftlichen Betrieb. Ihre Verdienste im Verfassungs- und Sozialrecht sind unbestritten. Aber es ist nicht die akademische Arbeit, die sie ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt – es ist die Art, wie sie sich zu politischen Fragen äußert: öffentlich, dezidiert, oft mit einer semantischen Schärfe, die im Munde einer zukünftigen Verfassungsrichterin ein Problem darstellt.
Die Aussage in einer Talkshow, man müsse die AfD-Anhängerschaft „beseitigen“, war kein bloßer Lapsus. Sie war Symptom einer Mentalität, die politische Gegner nicht als legitime Opposition behandelt, sondern als verfassungsrechtliches Problem, das es zu lösen gilt.
Denn der Rechtsstaat lebt nicht von der moralischen Überlegenheit seiner Richter, sondern von deren Fähigkeit zur Unterscheidung. Zwischen Person und Position. Zwischen Recht und Politik. Zwischen Legitimität und Legalismus. Wo diese Unterscheidung erodiert, wird das Gericht selbst zum politischen Akteur. Und das ist, was wir gerade erleben.
Die Vermessung des demokratischen Spielfelds
Es ist kein Zufall, dass Brosius-Gersdorf sich für ein Verbot der AfD ausspricht, das Grundgesetz „gendern“ möchte und in der Impfpflicht eine verfassungsrechtlich gebotene Maßnahme sah. In der Summe ergibt diese “Haltung” ein ideologisches Koordinatensystem, das mit dem Anspruch auf Überparteilichkeit schwer vereinbar ist.
Was sich hier artikuliert, ist ein neues Verständnis von Verfassungsrecht: nicht als Regulativ zwischen konkurrierenden Freiheitsansprüchen, sondern als affirmativer Entwurf einer gesellschaftlichen Utopie. Die Verfassung wird nicht mehr als Rahmen, sondern als Werkzeug betrachtet – zur Erziehung, zur Disziplinierung, zur Transformation. Das aber ist ein Bruch mit dem freiheitlichen Geist, den das Grundgesetz einst atmete.
Die Transformation der Gerichtsbarkeit zur moralischen Institution
In einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten zunehmend durch moralische Codierung ersetzt werden, verwandelt sich auch das Bundesverfassungsgericht. Es wird nicht länger als Hüter des Rechts gesehen, sondern als Korrektiv des Politischen. Der Richter wird zum Agenten des Fortschritts, nicht mehr zum Schiedsrichter zwischen Recht und Macht, sondern zum Akteur im Diskurs.
Brosius-Gersdorf steht für genau diese Entwicklung. Ihre Berufung ist ein Symptom jener Verschiebung, die auch in anderen westlichen Demokratien zu beobachten ist: der Verlust institutioneller Distanz in Richtung weltanschaulicher Konvergenz. Die juristische Urteilskraft, einst Inbegriff republikanischer Vernunft, wird unterlaufen von einer normativen Agenda, die sich selbst als unverrückbar versteht – weil sie auf der „richtigen Seite der Geschichte“ steht.
Die Dialektik des Gesinnungsurteils
Man sollte sich nichts vormachen: Das Problem ist nicht Frauke Brosius-Gersdorf persönlich. Es ist strukturell. Denn mit jeder Besetzung dieser Art verschiebt sich das Koordinatensystem des Verfassungsgerichts ein wenig weiter – weg von der institutionellen Unparteilichkeit, hin zur politischen Resonanz. Und mit jeder dieser Verschiebungen wächst die Versuchung, das Gericht als verlängerten Arm parlamentarischer Mehrheiten zu begreifen – oder schlimmer: als Tribunal gegen „falsches Denken“.
Was bleibt dann vom Rechtsstaat? Er wird zur Kulisse. Eine semantische Hülle, in der Entscheidungen nicht mehr nach Prinzipien gefällt werden, sondern nach sozialer Erwünschtheit. Das Grundgesetz wird, im Namen seiner Weiterentwicklung, seiner Offenheit beraubt. Und der Pluralismus, den es einst garantieren sollte, verkommt zur Folie für administrative Pädagogik.
Die Rückkehr des Erziehungsstaates durch die Hintertür
Die Berufung Frauke Brosius-Gersdorfs ist keine Bagatelle. Sie ist ein Einschnitt. Nicht, weil sie inkompetent wäre – sondern weil sie zu kompetent ist, um nicht zu wissen, was sie tut. Ihre Positionen sind nicht missverstanden worden, sie sind Ausdruck eines juristischen Weltbilds, das die offene Gesellschaft durch die richtige ersetzt sehen will.
Ein Verfassungsgericht aber, das sich nicht mehr dem Streit öffnet, sondern ihm Grenzen setzt, ist kein Schiedsrichter mehr. Es wird Partei. Und eine Demokratie, in der das Gericht Partei wird, ist auf dem Weg, ihr Gleichgewicht zu verlieren. Nicht aus böser Absicht. Sondern aus moralischer Überzeugung. Und das war, historisch betrachtet, selten ein gutes Omen.


