Hilft Mitgefühl im Feminismus?
Als ich eines nachts aufwachte, ließ ein Traum mich mit der Frage wach zurück, wieviele Konfliktgespräche, in denen das Individuum selbst emotional involviert ist, es im Durchschnitt braucht, damit Ambiguitätstoleranz nicht nur ein Wort ist das der Mensch kognitiv begreift, sondern automatisiert im Nervensystem für gewünschte Ergebnisse sorgt, nämlich solchen, die sich nicht an fight-or-flight-Mechanismen entlang hangeln, sondern Konfliktfähigkeit, Resilienz und Gelassenheit mit sich bringen. In meiner nächtlichen Rechnung kam ich auf folgende Zahl: 3, nur 3 Konfliktgespräche braucht es — eins für die erste Erfahrung, die alles bisherige kräftig durchschüttelt, eins für die Wiederholung und eins für die Festigung. Das ist natürlich ausgesprochener Quatsch, aber die Wolfsstunde ist bekanntermaßen nicht Ratgeber, sondern ein biografischer Horrorfilm, den man hormongesteuert auszuhalten hat, als Frau in den Wechseljahren. Ich habe mich zu ausgereifterer Stunde noch einmal genauer mit den Konfliktfähigkeiten von uns Menschen, gerade in Bezug auf feministische Kritik, beschäftigt und ob diese Rechnung für euch Sinn macht, überlasst ihr bitte einfach nicht der Wolfsstunde, das wäre meine einzige Bitte.
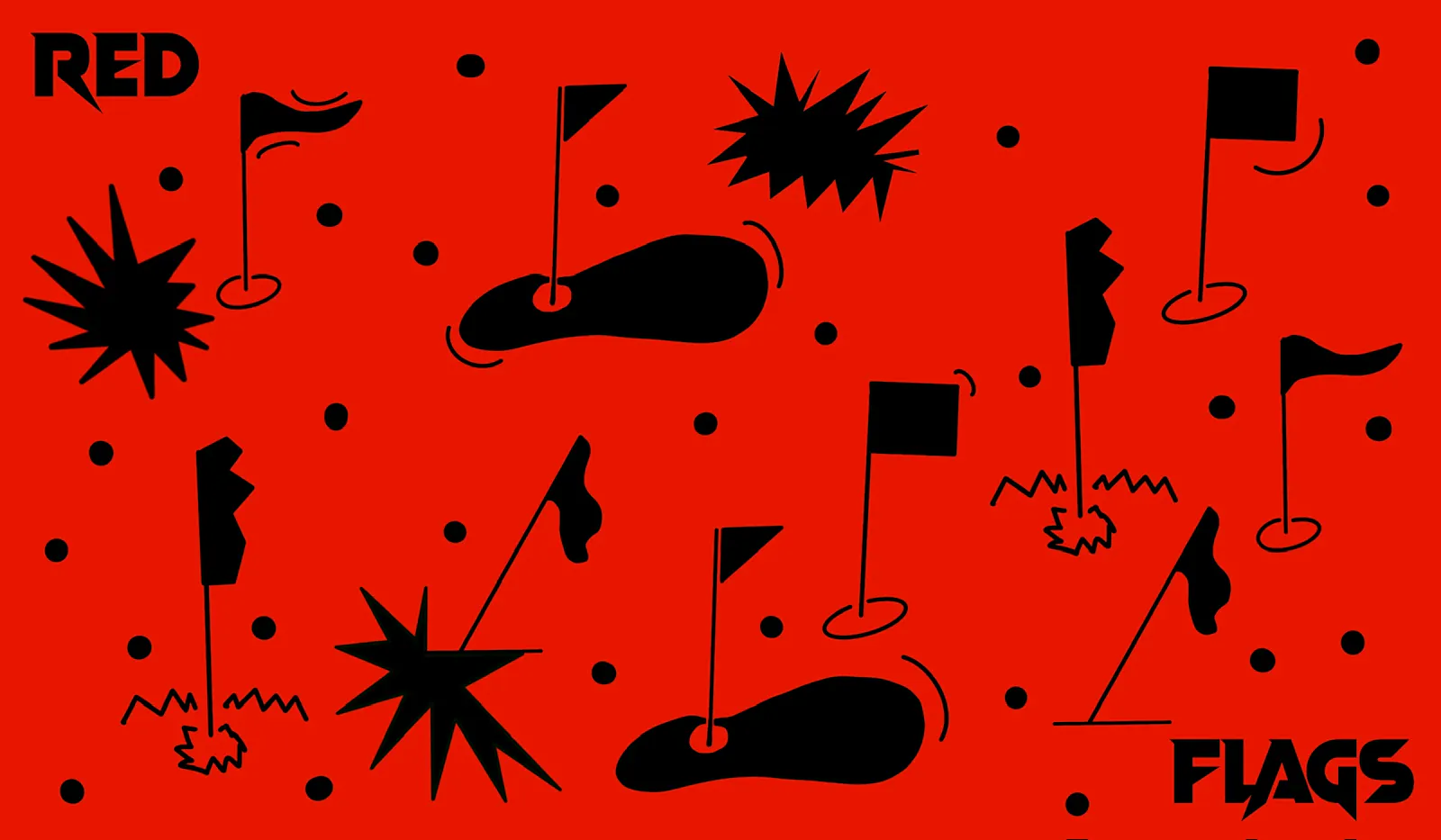
Wie ich im letzten Jahrzehnt oft neidvoll beobachtet habe, setzen junge Frauen immer selbstverständlicher Grenzen, beziehungsweise lösen sich aus Beziehungen — freund- und partnerschaftlichen, sowie familiären — sobald sie red flags am Gegenüber bemerken, die ihr Selbst, also ihr Ego, in irgendeiner Weise beschädigen könnten oder ihr Leben kleiner zu machen drohen. Das tun sie schon zu recht und es ist einerseits ein Fest das mit anzusehen; ein wenig wie die Metamorphose der Trickfilmfigur Popeye nach dem Spinatverzehr direkt aus der Dose; die jungen Frauen pumpen sich auf, schaffen sich Platz, mit Trotz, Wut, fotzfrech und dem zuschlagenden Selbstbewusstsein eines mittelalten durchschnittlich begabten weißen Mannes. Einfach toll. Und mehr müsste man dazu nicht sagen, man könnte es so stehen lassen und es fehlte nichts. Heute aber, füge ich ausnahmsweise doch etwas dazu; eine Perspektive, die es ebenfalls gibt und die nicht als Aber fungiert, sondern als Ergänzung.
Wenn Frauen mit ihren (potentiellen) Partnern, Freunden oder Vätern im Konflikt stehen und es geht um den Vorwurf der Unterdrückung, Misogynie oder mangelnder Verantwortungsübernahme in pragmatischen/familiären/emotionalen Angelegenheiten, fällt häufig der Satz, wenn sie sich ändern wöllten, dann würden sie es tun. Ich glaube diesen Satz auch selbst, denn in Bezug auf Privilegien und Vorteile, vor allem im beruflichen Kontext, gehört es zur Wahrheit, dass Menschen (alle Menschen) ihre Privilegien, die sie bereits haben, nur ungern aufgeben, eher sogar alles dafür in Bewegung setzen, dies nicht tun zu müssen. Wenn wir das Patriarchat kritisieren, ist dies eine strukturelle Kritik, die kein Aber, keine Banalisierung und keine Rechtfertigung dulden kann. Es ist Systemkritik, die am Ende allen hilft und ein besseres Leben verspricht, eines, das mit der Zeit geht, Progress enthält und sich für alle Menschen gleichwertig interessiert, unabhängig von Klasse, Herkunft, Geschlecht, Sexualität und Identität. In Sachen Beziehungen aber, die eine emotionale Involvierung beinhalten, stimmt dieser Satz wenn sie sich ändern wöllten, dann würden sie es tun nicht. Das ist eine viel zu einfache Erklärung für ein viel zu komplexes Gestricke. Oder hast du liebe Leserin/lieber Leser noch nie etwas wirklich umsetzen, entwickeln oder verändern wollen und es trotzdem nicht geschafft? Wie zum Beispiel die Ernährung dauerhaft auf gesund umstellen oder mit dem Rauchen aufhören oder einer Person vor der du riesen Manchetten hast, eine sehr kritische Meinung geigen. Und wieviele Anläufe hast du dafür gebraucht und wieviele unterstützende Worte aus deinem Umfeld?
Die Bewertung red flag eines individuellen Verhaltens in einer individuellen Situation, die ansonsten nicht das gesamte Bild ausmacht, klingt dann nicht nach Selbstermächtigung, gesund Grenzen setzen und Rückeroberung des eigenen Propriums, sondern nach Abwehrmechanismus und Konfliktunfähigkeit.
Das bedeutet nicht, dass Frauen ihre Partner in ihrem feministischen Kritisieren in Watte packen sollten oder die Dinge kleinreden, bevor sie überhaupt reden. Es bedeutet, dass Frauen ihren Partnern/Freunden/Vätern noch so viele Instagram oder TikTok Aufklär-Videos und feministische Literatur und faktenbasierte Dokus und Studienlagen vorlegen können, um sie zum Umdenken anregen zu können; erstens kommen sie damit WIEDER in die Rolle der Coachin/Therapeutin/Kümmerin und somit ins Hamsterrad des Überfunktionierens und Verantwortung übernehmens, wo sie keine haben sollten und zweitens werden sie ihre Partner nur auf der kognitiven Ebene damit erreichen, nicht aber auf der Ebene, die eingreift, wenn es zur Sache geht: dem Nervensystem.
Das Nervensystem ist körperlich, emotional und folgt Überlebensstrategien. Es sorgt für Herzrasen, Unruhe, Angst, Flucht- oder Kampfreflex, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen und alles was sich unsicher und bedrohlich anfühlt. Und wenn man bedenkt, dass Informationen, Argumente und Logiken mit dem präfrontalen Kortex, dem rationalen Teil des Gehirns verarbeitet werden, welcher auf Situationen mit gutem Urteilsvermögen und einem Bewusstsein für langfristige Konsequenzen reagiert, ist es doch nachvollziehbar, dass ein massives Unbehagen (auch bei Erwachsenen!) mit einer Überlastung des Nervensystems durchaus zum Aussetzen der Führfähigkeit des präfrontalen Kortex führen kann und somit der feministisch fleißig angelernte Mann im moment of truth nicht abruft, was er eigentlich schon besser weiß, sondern trotzdem in alte Muster fällt.
Nicht weil er nicht will, nicht weil er sich nicht drum schert, nicht weil er etwas anderes über die Partnerin priorisiert, sondern weil das Nervensystem nicht auf Informationen allein reagiert oder sich sicher fühlt, sondern auf körperliche und emotionale Erfahrung, die im Moment des Konflikts gemeinsam und sicher durchlebt werden darf. Langsam, geduldig, in Verbindung bleibend, nicht allein jedenfalls. Informationen und Argumente sind kognitiv, Stress durch eine heftige Auseinandersetzung legt den präfrontalen Kortex lahm und macht dem körperlichen und emotionalen Empfinden Platz, was sehr unterschiedlich intensiv erlebt werden kann, je nach Biografie und Prägung.
Und hier ist es — bei aller Allgemeinheit, die ich abhandle — ganz wichtig zu verstehen, dass damit natürlich nicht gemeint ist zu bleiben und mit präfrontaler-Kortex-Rechtfertigung zu argumentieren, wenn es immer wieder an den gleichen Stellen hakt. Das ist eine individuelle Entscheidung, die eines reiflichen Prozesses und Abwägens bedarf und vor allem als Akt der Selbstliebe und des sich selbst respektierens verstanden werden muss, wenn der Leidensdruck so hoch und die Toleranz für das immer wieder enttäuschende Verhalten nicht mehr vorhanden ist. Das ist eine Verantwortung, die Frauen ebenfalls für sich erkennen und annehmen müssen – den Partner nicht ändern zu wollen oder unendlich darauf zu warten, aber eben auch nicht gnaden- und emphatielos zu simplifizieren und zu beschämen.
Denn, weil viele damit argumentieren das sind doch Erwachsene, oder?, eines ist eben im Patriarchat auch klar: Männer sind nicht immer einfach emotional nicht erreichbar, aber emotional ungeübt. Es gibt hier einen Unterschied, der zählt. Die meisten Männer sind nicht unwillig, kalt oder nachlässig in der emotionalen Verbindung. Sie sind nur seit Jahrhunderten darauf trainiert ihre innere Welt zu vermeiden, die Kontrolle über sich und ihre Gefühle zu behalten, weiter zur Arbeit zu gehen, es wegzudrücken, runterzuschlucken und verdammt hart zu sein, weil das die sogenannte Stärke ist, die gesellschaftlich von ihnen erwartet wird. Also ist es doch auf eine emphatische Weise sehr nachvollziehbar, dass Männer einfrieren, wenn Frauen emotional werden; natürlich werden sie defensiv, wenn ihre unterdrückten Gefühle in ihrem Nervensystem einen Aufstand starten und alles droht aufzubrechen, was jahrelang gesammelt und gedeckelt wird. Das Gute und das Ungute sucht sich immer seinen Weg im Körper, auf die ein oder andere Weise. Männern wird das Fühlen abgewöhnt, noch bevor sie in die Schule kommen. Es sei denn es geht um Wut, die ist ok, wird sogar als besonders männlich betrachtet. Für Frauen hingegen ist es im Patriarchat von Anfang an völlig normal emotional zu sein, auch im Miteinander. Niemand würde zwei Mädchen, die sich in die Hände klatschend und mit hohem Stimmgewirr freudig begrüßen schräg und befremdet anschauen oder sogar zurechtweisen. Das Erleben, Durchfühlen und Teilen von sehr komplexen und mannigfaltigen Emotionen (außer Wut natürlich) ist uns Frauen nicht nur erlaubt, es wird erwartet und ist wesentlicher Bestandteil von konstruierter Weiblichkeit. Das ist ein weiblicher Raum, ein Privileg, das uns Frauen gehört, Jungen und Männern aber nicht.
Die ersten Opfer des Patriarchats sind Jungen.
Denn Boys dont cry (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), nach wie vor. Das ist alles so binär. Virile Eigenschaften und geschlechterspezifische Codes sind so stabil wie ein russisches Brecheisen.
Meine Gedanken zu vorhandener oder nicht vorhandener Konfliktfähigkeit und der Fähigkeit im Moment der Übernahme des zentralen Nervenstems trotzdem mit dem präfrontalen Kortex noch online zu sein, gelten übrigens natürlich für jede Art von Konflikt, mit jeder Art von Mensch. Es ist legitim nach einem misslungenen, entglittenen Konflikt (oder mehreren) von einem Menschen Abschied zu nehmen oder Abstand zu halten, wenn man für sich selbst spürt, dass die Toleranz für dieses oder jenes Verhalten nicht (mehr) vorhanden ist. Aber es ist dürftig und unterkomplex, dies zu begründen mit wenn sie sich ändern wöllten, dann würden sie es tun. Jeder Mensch trägt das Potential mit sich, in scheinbar rationalen Momenten, zum Beispiel im Job, wenn konstruktive Kritik geübt wird, irrational und emotional zu reagieren. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber die Menschen, die es überhaupt nicht gewohnt sind, tief in ihre innere Welt einzutauchen und verschiedene Gefühle zu fühlen, sie sicher zu durchleben und dann auch mit anderen zu teilen, die tragen das größte Potential bei Konfrontation impulsiv, defensiv, irrational und emotional zu reagieren und dem präfrontalen Kortex den Stecker zu ziehen. Ein aktuelles und sehr passendes Beispiel ist der öffentlich ausgetragene Konflikt vom letzten Wochenende zwischen Musk und Trump, der nebenbei, wie ihr hoffentlich schon selbst realisiert habt, in der Berichterstattung sehr großzügig misogyn beschrieben wurde und zum „Zickenkrieg“ erklärt oder als „hysterische Reality-TV-Hausfrauen“ verspottet wurde. Und social media springt auf den frauenhassenden und homophoben Zug auf unter Hashtags wie #girlfight #bitchfight #diva und Tweets wie „big beautiful breakup“ gingen viral als Inszenierung eines typisch schwulen Gefühlsausbruchs, wie Alexandra Zykonov schreibt (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Fazit: Feminismus und Konflikt ja, aber mit-gefühl. Es kann schwer und zehrend sein, mit Menschen in Verbindung zu bleiben, mit denen es eigentlich unmöglich scheint Konflikte und Widersprüche auszuhalten, mit denen es bedeutet Hiebe, Verletzungen und Enttäuschungen in Kauf zu nehmen. Was passiert denn aber, wenn wir bei jeder Unstimmigkeit, bei jedem impulsiven Nervensystem-Patzer Verbindungen lösen und vor dem offen ausgetragenen Konflikt, der ja auch ruhig in Nervensystem freundlichen Intervallen stattfinden kann, wegrennen, weil wir denken, dass red flags nunmal einfach gar nicht gehen und wir nur so unser Überleben sichern können? Überleben wir dann oder sterben wir einsam?
Es grüßt, Christin
Wenn ihr meinen Newsletter WORTSPIELFELD mögt und unterstützen möchtet, freu ich mich sehr, wenn ihr ein Mitglieds-Paket (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) abschließt und mir die Zeit dafür ermöglicht, ihn regelmäßig zu schreiben. Danke.

