Warum junge Menschen in China und Deutschland gleich fühlen
Junge Menschen aus China und Deutschland leben in völlig unterschiedlichen Welten. Trotzdem sind sie sich so ähnlich wie kaum zuvor. Warum, erkläre ich dir in diesem Text.
 (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)„Viele meiner Freunde in China fühlen sich verloren und einsam. Wenn ich mit ihnen spreche, spüre ich viel negative Energie“, sagt Tiantian. Die 28-jährige Graphikdesignerin und Social Media Managerin hatte in Shanghai viele internationale Freunde und genoss die kreative Atmosphäre in der Stadt – bis zur Corona-Pandemie. „Danach fühlte sich die Stadt plötzlich kalt und taub an. Das war nicht mehr das Shanghai, das ich kannte und liebte.“
Vor zwei Jahren ist Tiantian nach Bali ausgewandert, wo sie Bewusstseins-Coachings anbietet und ihrer Surfleidenschaft nachgeht. „Der Rhythmus ist entspannter, die Menschen gemeinschaftlicher, das Leben gesünder“, schwärmt sie. Nach China zurückzukehren, kann sie sich derzeit nicht vorstellen.
Junge Menschen in Deutschland und China wachsen in komplett unterschiedlichen Welten auf: Overheadprojektor und politische Debatten in Klassenzimmern auf der einen Seite, Künstliche Intelligenz und Marxismus-Pflichtkurse im Unterricht auf der anderen. Nach dem Abitur gehen viele junge Deutsche reisen oder jobben erstmal ein Jahr lang. Für junge Chines:innen geht es nach einer zermürbenden Hochschulprüfung, der gaokao, oft direkt an die Uni.
Zwischen diesen Welten gab es kaum Anknüpfungspunkte — bis jetzt. Heute, wo die Welt von einer Krise in die nächste stürzt, ähnelt sich die Lebensrealität junger Menschen in China und Deutschland so sehr wie noch nie zuvor.
Warum junge Menschen in China so desillusioniert sind
Seinen Anfang nahm diesen Phänomen mit dem großen Gleichmacher, der Corona-Pandemie. Sowohl in China als auch in Europa hockten junge Menschen monatelang zuhause und sahen die spannendsten Jahre ihres Lebens an sich vorbeiziehen. Auch jetzt, Jahre nach Ende der Pandemie, hadern viele mit der Vorahnung, dass die Zukunft angesichts weltweiter Aufrüstung, Wirtschaftskrisen und Klimawandel nicht viel Gutes bereithält. Dabei galten zumindest Chines:innen im weltweiten Vergleich lange als besonders optimistisch.
Bis in die 2010er Jahre hinein trieb das Aufstiegsversprechen viele Menschen in China zu Höchstleistungen an, für die sie sogar Familie und Beziehungen vernachlässigten. Der Autor Peter Hessler, der in den 1990er Jahren in einer Kleinstadt in Sichuan unterrichtete, erzählt in seinem Buch “Other Rivers” die Geschichte von Youngsea, ein junger Mann, der sich in den frühen 2000ern ein Konglomerat im Baugewerbe erarbeitete (Chines:innen suchen sich ihre englischen Namen häufig selbst aus. Youngsea ist die wörtliche Übersetzung seines chinesischen Künstlernamens).
Tag und Nacht arbeiteten er und seine Frau, um die Konkurrenz zu überlisten. Seine Frau begann, sich vernachlässigt zu fühlen. Und schließlich, auf dem Höhepunkt seines Erfolges, verließ sie ihn. “Das war echte Liebe zwischen uns”, erzählt Youngsea. “Aber das Streben nach Geld war stärker als alles andere.”
Auch wenn Youngsea die Liebe verloren hat: Vermutlich gehörte er zu den 70 Prozent der Chines:innen, die zwischen 2004 und 2014 in einer Studie (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) des Stanford Center on China’s Economy and Institutions (SCCEI) angaben, ihr Leben sei zu diesem Moment besser als vor fünf Jahren.
Inzwischen hat sich dieser Wert fast halbiert: Im Jahr 2023 gaben in derselben Studie nur noch 38 Prozent der Menschen in China an, dieser Ansicht zu sein. Ganz besonders desillusioniert sind junge Chines:innen. Sie leiden ganz besonders unter der derzeitig schlechten Wirtschaftslage in China. „Eine Welt, in der man durch harte Arbeit Sinn finden konnte, hat sich in eine Welt verwandelt, in der selbst durch harte Arbeit kein Sinn gefunden werden kann“, schreibt dazu das chinesische Jugendmagazin Youthology (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Auch in Deutschland sind junge Menschen im Dauerkrisen-Modus (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Hier zählen zu den häufigsten Gründen die Inflation, teurer Wohnraum und die Kriege in der Ukraine und Nahost. Junge Menschen in China und Deutschland eint das Gefühl: Was hält diese Welt eigentlich Gutes für mich bereit?
Sollen sie doch Bitterkeit essen
In China und Deutschland überaltert die Gesellschaft, Jugendliche und junge Erwachsene werden zu einer immer kleineren Minderheit. Dadurch wächst das Gefühl, von der Politik kaum gehört zu werden. Die hat sowohl in China als auch in Deutschland ähnliche Antworten auf die Zukunfts-Verunsicherung parat: So behauptete Bundeskanzler Friedrich Merz: „Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können.“ Und in China riet Xi Jinping jungen Menschen schulterzuckend, “Bitterkeit zu essen” — ein chinesischer Ausdruck, der in etwa “Zähne zusammenbeißen” bedeutet und an revolutionäre Werte aus den Zeiten sozialistischer Kampagnen erinnert.
Hart arbeiten tun junge Deutsche und Chines:innen dabei sehr wohl. Junge Deutsche arbeiten so viel wie kaum zuvor (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Und viele junge Chines:innen hangeln sich von Gig zu Gig. Im Chinesischen hat sich dafür der Ausdruck neijuan, Involution, etabliert. Sie bezeichnet einen harten Konkurrenzkampf, der für alle Beteiligten ruinös ist.
Das zeigt: Unter jungen Menschen klaffen Ideal und Realität weit auseinander. Auszusteigen oder sich mit der “Flachliegen” "Bewegung dem Leistungsdruck zu entziehen — davon können die meisten nur träumen. In der Realität sehen sich viele gezwungen, innerhalb dieses Systems zu funktionieren.
Keine Ehe, keine Kinder, den Frieden bewahren
Noch eine weitere Gemeinsamkeit: Immer weniger junge Menschen in Deutschland und China können einem heterosexuellen Familienbild etwas abgewinnen. „Die meisten meiner Freundinnen vertrauen Männern nicht, sie wollen ihr Leben lang Single bleiben“, sagt Tiantian. 2022 gab fast die Hälfte der Befragten einer Umfrage der Chinese Academy of Sciences (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) unter 20- bis 24-Jährigen an, nicht auf der Suche nach einer Beziehung zu sein. Insbesondere junge Frauen in chinesischen Großstädten ziehen derzeit eine Karriere und ein unbeschwertes Single-Leben der traditionellen Familie vor. Hashtags wie #不婚不育保平安 (Keine Ehe, keine Kinder, den Frieden bewahren) können mühelos anknüpfen an Trends wie die 4B-Bewegung, die aus Südkorea nach Europa schwappte. Die 4B-Bewegung lehnt ebenfalls Heiraten und Mutterschaft ab.
Auch in Deutschland sind junge Erwachsene Co-Parenting und Wahlfamilien gegenüber aufgeschlossener als ihre Eltern. Zudem wächst die Zahl junger Menschen, die sich der LGBT-Community zugehörig fühlt.
In China und Deutschland wachsen junge Menschen in einer Welt auf, die immer vernetzter, aber weniger kosmopolitisch wird. Sie müssen den Klimawandel, technologische Revolutionen und Schwächen des wachstumsbasierten Wirtschaftssystems bewältigen. Oder, wie der Anthropologe Xiang Biao in einem Interview (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) mit dem Magazin Sixth Tone feststellt: „Junge Menschen stehen vor einer existenziellen Lebensfrage: Sie müssen herausfinden, wie man ein Umfeld, das man nicht akzeptieren will, grundlegend neu denkt.“
How to China ist zurück aus einer kleinen Sommerpause — hier (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) kannst du mir sagen, was du von dieser Ausgabe hältst! Dieser Text ist zuerst in leicht veränderter Fassung bei China.Table (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) erschienen.
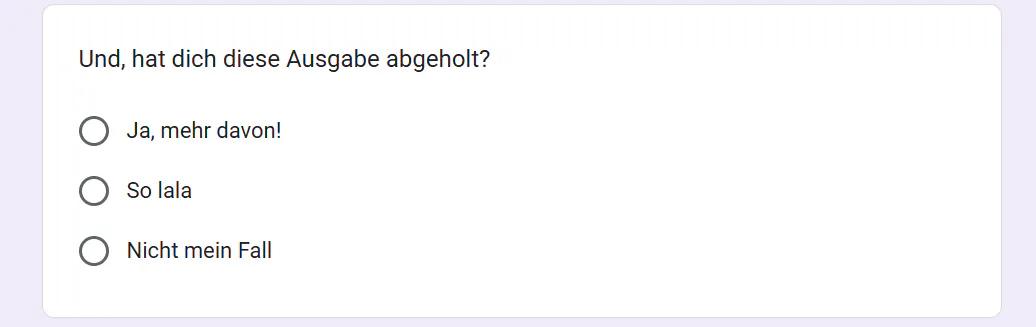 (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)


