Jetzt geht’s ans Eingemachte
Seit Jahren steht ein sehr großer unsichtbarer Elefant im Raum unserer gesellschaftlichen Diskurse. Manche wissen, dass es ihn gibt, aber verschweigen ihn, andere verteidigen ihn, wieder andere haben sich vielleicht noch nie Gedanken über ihn gemacht, aber er ist da.
Heute werde ich einen Rundumschlag machen, was meine Beobachtungen über ihn betrifft, denn mich beschäftigt er schon seit nun über einem Jahrzehnt, und der Frust und Weltschmerz, den er auslöst, ist immer ein wesentlicher Treibstoff für meine künstlerische Arbeit an Szenarien alternativer Zukünfte gewesen.
Ich zähle dir jetzt ein paar Missstände auf, die dir vielleicht bekannt vorkommen und die alle auf eine gemeinsame Wurzel zurückgeführt werden können. Wenn du irgendwann glaubst, zu wissen, worum es geht, kannst du natürlich auch runter bis zum letzten Abschnitt scrollen, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht.

1.) Letztens saß ich bei einem Vortrag, in dem es um die prekären Arbeitsbedingungen in Textilfabriken des globalen Südens und Fast Fashion ging, bei dem unentwegt neue Mode auf den Markt geworfen wird. Jemand bemerkte am Ende sinngemäß, dass es eigentlich darum gehen müsste, die lokalen Wirtschaftskreisläufe vor Ort zu stärken, damit die Leute unabhängiger von Großkonzernen würden. Die Referentin zuckte mit den Schultern: „Mag sein. Für solche Lösungen, die die Fundamente der globalen Textilbranche in Frage stellen, werde ich aber leider nicht von den Geldgebern unseres Projekts bezahlt.“ Warum nicht?
2.) Hast du dich auch schon mal aufgeregt, dass in Großstädten eine Wohnung zu finden zum Kunststück geworden ist? Die Mieten steigen immer weiter und man kommt politisch nicht nach, Wohnraum zu schaffen. Warum ist das so?
3.) Hast du dich auch schon einmal aufgeregt, dass du dir schon wieder ein neues technisches Zubehör/Accessoire/Gerät/Kleidungsstück kaufen musst, weil das alte nach wenigen Monaten kaputt gegangen ist? Headsets geben an einer Sollbruchstelle nach ein paar Monaten den Geist auf, Teelichterdochte gehen aus, obwohl noch die Hälfte des Wachses drin ist. Warum sind sie nicht auf lange Haltbarkeit designt?
4.) Kürzlich las ich einen Insta-Post: Vor Afrikas Küsten fischen internationale Fischereiflotten die Ozeane leer, sodass lokale Fischer zu wenig fangen, kein ausreichendes Einkommen mehr generieren und so etwa nach Europa auswandern müssen. Warum können die Konzerne kein rechtes Maß halten, um die Bestände zu schützen?

5.) Hast du dich auch schon mal darüber geärgert, dass jährlich zig Tonnen an Lebensmitteln einfach weggeworfen werden? Warum scheint es die rationalste Option für Produzenten zu sein, so etwas zu tun?
6.) Die Bundesregierung fördert den Bau von elektrobetriebenen Autos. Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn man Emissionen sparen will, flächendeckend und strategisch smarte Mobilitäts-Netze aus verschiedenen Verkehrsmitteln auszubauen, in denen sich Leute Fahrdienste teilen und Emissionen sparen, statt alleine in überdimensionalen SUVs herumzufahren? Warum wird diese Idee nie diskutiert geschweige denn ernsthaft erwogen?
7.) Macht es dich auch regelmäßig traurig, dass täglich unzählige Schweine, Hühner und andere Tiere unter lebensunwürdigen Mastbedingungen leiden – welche Gesellschaften der Zukunft wahrscheinlich als Verbrechen einordnen werden – eingezwängt auf winzigen Flächen, verletzt, vollgepumpt mit Medikamenten, ohne Tageslicht? Warum ist das notwendig?
8.) Während Corona wurden die Zustände, die auf den Pflegestationen herrschen, noch offensichtlicher. Personal arbeitet sich kaputt, für Patienten ist keine Zeit, unnütze Operationen nehmen zu, Geburten sind für viele Frauen traumatisch, weil funktional, unpersönlich, mit technischem Eingriff vor Respekt eigentlicher Bedürfnisse. Warum ändert sich nichts, wenn alle doch die Missstände erkannt haben?
Wirst du ungeduldig? Wenn du jetzt denkst ‚Ja, das sind so allgemeine Konflikte, aber mich regen die aktuellen politischen Themen noch viel mehr auf, die Welt wird immer nur verrückter!’ dann lass uns doch darüber sprechen.

Krieg - ein Geschäft wie jedes andere?
9.) In Deutschland spricht der Verteidigungsminister wieder von Kriegswirtschaft und unbegrenzte (?!) Investitionsbudgets für Aufrüstung wurden kürzlich politisch durchgewunken.
In Osteuropa und in Nahost rüstet man weiter auf. Dazu kauft man Waffen bei globalen Rüstungskonzernen wie Rheinmetall (DE), Northrop Gruman (US), BAE Systems (UK) ein. Das Vermögen dieser Konzerne wird u.a. verwaltet durch das Unternehmen BlackRock, das zudem Anteile an fast allen großen börsennotierten Konzernen, also an den Digitalriesen, Großbanken, Energie, Pharmariesen, Lebensmittel- und Industriekonzernen hält.
Dieser Vermögensverwalter profitiert vom Krieg in der Ukraine aktuell an ihrer Zerstörung als auch später an ihrem geplanten Aufbau: Aktuell steigen die Gewinne für Rüstungshersteller. Nach dem Krieg wird das Unternehmen als Architekt und Katalysator des Wiederaufbaus fungieren und verwaltet dann mit einer Reconstruction Bank öffentliche Gelder, um westlichen Großinvestoren mehr Einfluss auf ukrainischen Märkten zu verschaffen.
Zu denen, die politisch über die Aufrüstung entscheiden, scheinen enge Verbindungen zu bestehen. Wechselte bereits Merkels ehemaliger Wirtschaftsberater später zu BlackRock, so wurde während der Ampel Habecks Wirtschaftsministerium von einer ehemaligen BlackRock-Mitarbeiterin geleitet, der aktuelle Kanzler saß im Aufsichtsrat. BlackRock berät punktuell auch die EZB. Wie weit oder kurz auch immer Einflussnahmen reichen mögen, soll hier gar nicht Thema sein:
Fakt ist, dass die Rüstungsindustrie und die, die daran mitverdienen, nie ein Interesse daran haben wird, dauerhaften Frieden zu schaffen. Aber warum wird das allgemein akzeptiert?

Okay – vielleicht belasten dich persönlich aber noch mehr die ideologischen Kampffronten zwischen rechts und links, sei es in den sozialen Medien, im Bundestag oder in den USA?
10.) Die einen sind überzeugt, dass mehr gespart werden und Bürokratie abgebaut werden muss, dann werde das schon wieder. Die anderen wollen großflächig investieren, um das Wachstum anzukurbeln. Zuletzt zeigte sich dieser Grabenkampf in der Entfremdung von Musk und Trump in ebendieser Frage: Trump plant Neuverschuldung, Musk, der monatelang versucht hatte, rabiat Staatsausgaben abzubauen, kritisierte dies scharf. Das allgemeine Dilemma lautet: Weniger Investitionen heißt weniger Wohlstand. Mehr Investitionen heißt aber auch mehr Verschuldung, also am Ende auch weniger Wohlstand. Aber warum eigentlich genau?
Vielleicht denkst du jetzt: Na gut, das sind politische Themen. Ich konzentriere mich ganz auf mein privates Leben, wo ich wirklich was verändern kann, mich frustriert das alles zu sehr …
Gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter.

11.) Hast du auch schon mal gedacht, dass dir acht Stunden Arbeitsalltag eigentlich zu viel sind, zu monoton, zu fordernd? Lebst du immer oder manchmal auf Feierabend, Wochenende und den nächsten Urlaub hin?
12.) Oder hast du allgemein privat das Gefühl, immer zu wenig zu sein oder zu leisten, dass du eigentlich nie genug bist? Und wenn ja: Woher kommt das?
Die Mutter aller Probleme
So.
Vielleicht hast du es schon geahnt. Die Wurzel all dieser Probleme, direkt oder indirekt, heißt Wachstumszwang – ein Wort, das wir alle ständig hören: Die Wirtschaft ist gezwungen, jährlich zu wachsen, wenn unser Wohlstand erhalten bleiben (nicht bloß wachsen!) soll. Deshalb sind alle besorgt, wenn sie es nicht tut, was in den letzten Jahren zum neuen Normal geworden ist. Deshalb sind Unternehmen und Staaten, die sich wie Unternehmen verhalten, gezwungen, ständig mehr Profite zu machen, zu skalieren, Kosten zu sparen, anstatt finanziell da zu bleiben, wo sie sind.
Das Wachstum hat der Club of Rome mit seiner „Grenzen des Wachstums“-Debatte 1972 schon zum Thema gemacht – allerdings ging es damals um die physikalisch-ökologische Seite, dass es nicht möglich ist, unbegrenzt Ressourcen auf einem begrenzten Planeten zu verbrauchen.
Der britische Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Tim Jackson hat dann vor über einem Jahrzehnt anschaulich aufgezeigt: Selbst wenn wir wollten, wir dürfen nicht aufhören mit dem Wachstum, denn es reicht für den Staat nicht, ein gleich bleibendes BIP zu erwirtschaften. Von ihm hängt ab, ob es genug Arbeitsplätze gibt, genug Steuern eingenommen werden und Schulden zurückgezahlt werden können. Dieser Wachstumszwang, dem alle anderen Werte untergeordnet werden müssen, führt aber zu mehr und mehr Ausbeutung von Umwelt und Mensch und teilweise absurden Zuständen und Entscheidungen, wie wir oben gesehen haben.
Deshalb liegen sowohl die Rechten als auch die Linken, was Sparen versus Verschuldung angeht, falsch – oder sie verschweigen die Wahrheit. Keins von beiden wird zu einer Lösung führen.
Aber: Fragst du dich jetzt, warum denn überhaupt die Unternehmen und Staaten gezwungen sind, die Gewinne bzw. das BIP immer weiter zu steigern?
Hat unser System Krebs – im Endstadium?
Das hat schlicht mit dem System der Zinsen zu tun. Der Anthroposoph und Betriebswirt Matthias Augsburg stellt die These auf, dass dieser Mechanismus, der im Spätmittelalter eingeführt wurde und sich in der frühen Neuzeit durchsetzte und auch „Wucher“ hieß, vergleichbar ist mit dem Wachstum von Krebszellen. Geld wird mit Geld statt mit echter Arbeit verdient, indem diejenigen, die sich Geld leihen, später mehr zurückzahlen müssen, als sie sich geliehen haben. Das heißt, sie müssen also mehr arbeiten, erwirtschaften, einnehmen als nötig wäre.
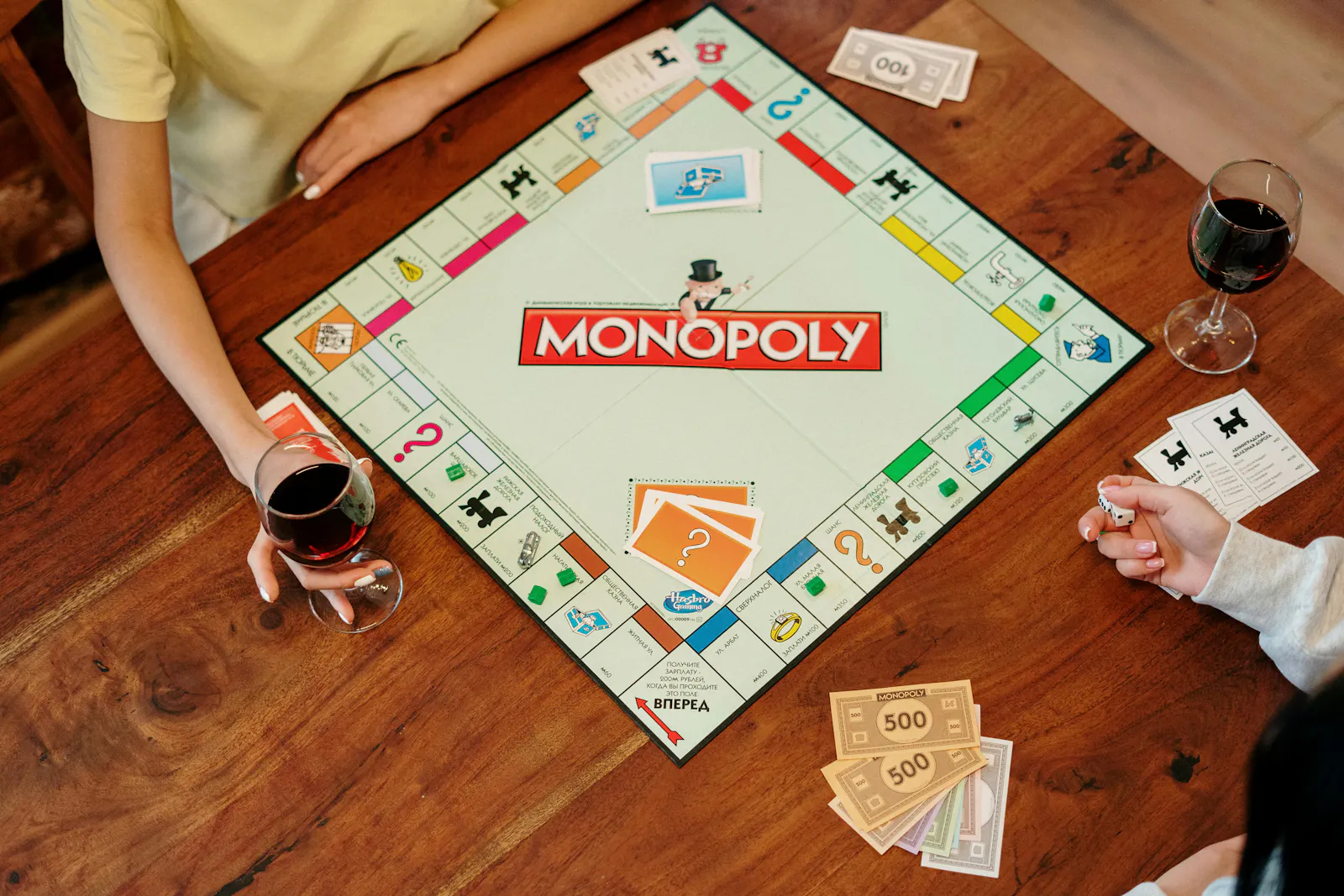
Unternehmen, die Kredite aufnehmen, müssen wieder mehr Gewinn als für die Produktion usw. nötig erwirtschaften, um ihre Schulden begleichen zu können und zugleich mit neuen Krediten (=neuen Schulden) weiter investieren zu können. In der Natur gibt es diesen Zwang, dauerhaft wachsende Erträge zu erzielen, aber nicht. Generell wachsen Phänomene nicht ewig, sondern nur in Phasen. Es gibt den wachstumsreichen Frühling und ertragreichen Sommer und Herbst, aber auch den kargen Winter. Ein Baum hört irgendwann auf zu wachsen und geht in die Breite. Die Körpergröße eines Menschen stagniert irgendwann oder schrumpft sogar ein wenig. Nur im Falle von Krebs wuchern Zellen so lange, bis sie den ganzen Organismus zu Fall bringen.
Im Falle des BIP eines Staates, also dem Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum produziert werden, heißt das, dass die Arbeitsleistung bzw. Gewinne immer weiter steigen müssten, damit der Wohlstand überhaupt erstmal stabil bleiben kann. Die Zinsen wandern oft nicht zurück in den Geldkreislauf, sondern häufen sich bei wenigen an, die schon viel haben. So wird das Geld strukturell umverteilt von unten nach oben, unaufhaltsam, aus Prinzip, nicht aus Boshaftigkeit.
Wenn das stimmt, ist das … krass
Und jetzt kommt’s:
Augsburg zufolge führt dieser Mechanismus dazu, dass Volkswirtschaften regelmäßig in sich zusammenfallen, wenn ihr 60-80-jähriger Wachstumszyklus an ein Ende gekommen und Wachstum schlicht nicht mehr möglich ist. In diesem Endstadium treten dann schwere Krisen, gesellschaftliche ideologische Spaltungen und Kriege auf. Da Krieg Zerstörung heißt, kann die zerstörte Gesellschaft danach neu aufgebaut und so neues Wachstum generiert werden. Die Interessen von Staat, großen Marktakteuren und Vermögenden verschmelzen kurz vor Schluss immer mehr. Das ist das, was vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges passierte, als Hitlers Pläne und Kooperationen die Industrieproduktion (z.B. die Chemie-Branche) ankurbelten und für neues Wachstum sorgten.
Aber wenn das stimmt und wir am erneuten Ende des Wachstums-Kreislaufs angelangt sind – was kann dann die Alternative sein zu einer kollektiven Zerstörung unserer Lebensgrundlagen?
Wir haben dann keine andere Wahl, als uns über Alternativen Gedanken zu machen. Die werden aber immer noch als Nischen-Thema abgestempelt. Meine These: Wir fürchten uns kollektiv vor großen Entwürfen, vielleicht, weil sie in der Vergangenheit schon gescheitert sind. Niemand will verantwortlich für Chaos sein, deshalb bleibt man im Klein-Klein.
Vielleicht braucht es deshalb sanfte Übergangslösungen wie Grundeinkommen o.ä., um Zeit zu gewinnen für umfassende Forschung und praxisorientierte Reallabore, keine zentralistischen Umsturzphantasien.

Ein Happy End
Die neue Ordnung wird dann mit Balance zu tun haben müssen und mit lokalisieren, dezentralisieren, entschleunigen. Denn wie wir jetzt wissen: Das Wachstum zu stoppen, ohne etwas systemisch zu ändern, zerstört den Wohlstand. Armut, mangelnde Gesundheits/Mobilitäts/Pflegedienstleistungen müssten lokal aufgefangen durch neue Strukturen, der Geldkreislauf bräuchte eine Umlaufsicherung, sodass das Geld nicht aus der lokalen Wirtschaft abfließen kann, und große Investitionen könnten durch zinslose Darlehen und Crowdfunding erfolgen.
Als versöhnliches Ende dieses Blogartikels und zur persönlichen Inspiration findest du hier den Bericht eines Reallabors im Werra-Meißner-Kreis (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), die schon angefangen haben, Strukturen jenseits von Wachstumszwängen zu denken und mit beteiligten Akteur*innen konkret zu planen. Hier kann man sehen, wo die Reise (zum Beispiel) hingehen kann.
Mich persönlich berühren die oben genannten Missstände ehrlich gesagt nur noch oberflächlich. Nicht, weil ich abgestumpft bin, sondern weil es mit diesem Wissen um die Zusammenhänge einfach Zeit- und Energieverschwendung wäre, sich an ihnen aufzureiben. Stattdessen gibt es mir jeden Tag Kraft, künstlerisch Szenarien zu erforschen, in denen neue systemische Bedingungen schon zu Realität geworden sind.
Denn dann ist es ein bisschen schon so, als wären sie bereits da.
Quellen:
Bilder: pexels
Tim Jackson: Wohlstand ohne Wachstum – Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt. München 2011.
Mit ChatGPT findest du schnell stützende Nachrichtenartikel und Websites zu den Fakten.
Die These von Augsburg habe ich aus einem Video-Interview eines Online-Summit mit ihm, auf das ich jedoch keinen Zugriff habe.


