Wege zu einer besseren KI
Feminismus trifft auf Algorithmus

Künstliche Intelligenz verändert Gesellschaften – doch wer bestimmt ihre Regeln? In Frankreich prägen Fachleute den Diskurs. Mit einem klaren Blick auf Ethik, Mitbestimmung und gesellschaftliche Auswirkungen gestalten sie gemeinsam eine KI-Politik, die nicht nur effizient, sondern fair sein will.
Frankreich setzt auf eine inklusive KI-Politik mit weiblicher Führungsstärke. Expertinnen wie Anne Bouverot und Clara Chappaz bringen Ethik, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe in die Debatte ein. Programme fördern gezielt Mädchen und Frauen, um Diskriminierung durch KI zu verhindern. Mit Bildungsinitiativen, Quoten und internationalen Impulsen positioniert sich Frankreich als Vorreiter für eine faire, gemeinwohlorientierte KI.
Von Anna Schütz, Montpellier
Frankreich hat sich 2025 an die Spitze der internationalen Debatte um Künstliche Intelligenz gesetzt. Als Gastgeber des sogenannten „AI Action Summit“, der im Februar diesen Jahres in Paris stattfand, lenkte das Land den Blick weg von rein technikgetriebenen Fragen hin zu politischen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen der KI: Wie verändert sie etwa die Arbeitswelt und soziale Strukturen? Welche Rolle spielt sie im Kampf gegen den Klimawandel? Und wer trägt die Verantwortung für die Entscheidungen, die intelligente Systeme künftig treffen?
Unter der Leitung von Präsident Emmanuel Macron und seiner Sonderbeauftragten für KI, Anne Bouverot, wurde deutlich: Es geht nicht mehr nur darum, was KI leisten kann, sondern auch darum, wer sie gestaltet und zu welchem Zweck. „Die Pariser Maßnahmen für Künstliche Intelligenz weisen den Weg für eine gemeinsame, fortschrittliche Entwicklung der KI. Dabei geht es darum, den digitalen Wandel mit dem ökologischen Wandel in Einklang zu bringen, KI zur Schaffung von Arbeitsplätzen statt zu deren Verdrängung einzusetzen und sicherzustellen, dass Künstliche Intelligenz dem Gemeinwohl dient“, so Bouverot.

Dabei fällt auf, dass in Frankreich eine vielfältige Gruppe von Expert*innen diesen Wandel vorantreibt. Vor allem engagierte Frauen bringen dabei verstärkt ethische Prinzipien, gesellschaftspolitische Perspektiven und eine neue Haltung in die Diskussion ein – und verändern damit nicht nur den Ton, sondern auch die Richtung der nationalen KI-Strategie.
Verantwortung statt Technokratie
Mit seiner „Stratégie nationale pour l’IA“ verfolgt Frankreich seit 2018 einen ambitionierten, langfristigen Ansatz, der die Potenziale der KI nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und ethisch nutzt. In der ersten Phase lag der Fokus auf dem Aufbau wissenschaftlicher Exzellenz und der Förderung von Forschungseinrichtungen. Die zweite Phase konzentrierte sich dann auf die Stärkung von Strukturen für KI-Innovation, insbesondere durch Investitionen in Start-ups und die Vernetzung von Forschung und Wirtschaft.
Die dritte Phase der Strategie, die in diesem Jahr begonnen hat, definiert nun vier zentrale Schwerpunkte: den Aufbau leistungsfähiger technischer Infrastrukturen, die gezielte Förderung von (jungen) Fachkräften, die breite Integration von KI in alle gesellschaftlichen Bereiche sowie die Entwicklung einer „IA de confiance“, und damit einer vertrauenswürdigen, ethisch fundierten KI. Dafür stellt der Staat rund 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung.
Institutionalisierter Wandel
Frankreich will nicht nur als technologische Innovationsnation wahrgenommen werden, sondern nimmt gezielt Einfluss auf internationale Leitlinien zur KI-Regulierung. Durch aktive Mitarbeit in Gremien der EU, der OECD sowie auf Plattformen wie dem G7-Gipfel oder dem „AI Action Summit“ bringt das Land konkrete Vorschläge in globale Verhandlungen ein, etwa zu verbindlichen Transparenzstandards für KI-Systeme oder zur Einbindung ethischer Prinzipien in technologische Entwicklungsprozesse.
Beim „AI Action Summit (Si apre in una nuova finestra)“ betonte Bouverot: „Wir müssen eine KI entwickeln, die dem öffentlichen Interesse dient. (…) Ziel ist es, von reinen Science-Fiction-Szenarien zur Realität überzugehen“. Gleichzeitig sprach sie sich entschieden gegen freiwillige Selbstverpflichtungen der Tech-Konzerne aus und forderte eine starke politische Regulierung, um Missbrauch und Diskriminierung durch KI-Systeme wirksam zu verhindern.
Auch institutionell geht Frankreich neue Wege. Im Juni stellte Clara Chappaz, seit September 2024 erste Staatssekretärin – und mittlerweile Ministerin – für KI und Digitales, den neu gegründeten „Conseil national de l‘IA et du Numérique“ (CIAN), den Nationalrat für KI und Digitales, vor.
„In einer Zeit, in der die Digitalisierung noch nie so politisch war wie heute, schaffen wir uns mit dem CIAN einen Raum für freie, unabhängige, sachkundige und offene Überlegungen. Er wird das öffentliche Handeln im Bereich der künstlichen Intelligenz anregen und inspirieren“, unterstreicht die Ministerin. An der Spitze des 14-köpfigen Rates steht Chappaz selbst – co-präsidiert wird er von Anne Bouverot. Ein klares Zeichen für die weiblich geprägte Führungsstruktur in der französischen KI-Politik.
Bildung, Teilhabe, Empowerment
Was bedeutet es in der Praxis, wenn Frauen an zentraler Stelle die Entwicklung und Regulierung Künstlicher Intelligenz mitgestalten? Frankreich liefert zahlreiche Beispiele. Da wäre unter anderem die „Stiftung Blaise Pascal“, die sich der Förderung von Bildung in wissenschaftlichen Bereichen widmet, hat das Projekt „Capsules Éthique du Numérique pour les Enfants (Si apre in una nuova finestra)“ entwickelt. Es richtet sich an Kinder ab acht Jahren und thematisiert in animierten Lerneinheiten unter anderem algorithmische Verzerrungen, soziale Medien, Gender-Stereotype und den kritischen Umgang mit KI.
„Es sollen Lernkonzepte entwickelt werden, die dauerhaft im Unterricht verankert werden können. Die Lehrkräfte sollen dabei nicht nur unterrichten, sondern selbst im Prozess dazulernen. Es geht um eine gemeinsame Auseinandersetzung, bei der Lehrer zusammen mit ihren Schülern über diese Themen diskutieren“, erklärt Laurence Devillers, Präsidentin der Stiftung und KI-Ethik-Forscherin an der Sorbonne.
Ziel sei es, kritisches Denken im Umgang mit KI zu fördern und im Unterricht Fragen wie ‚Was ist dieses KI-gestützte Gerät eigentlich?‘, ‚Warum hänge ich so daran?‘ oder ‚Warum werde ich wütend, wenn man es mir wegnimmt?‘ zu thematisieren – um so einen bewussteren Umgang mit der KI-Technologie im Alltag zu entwickeln.
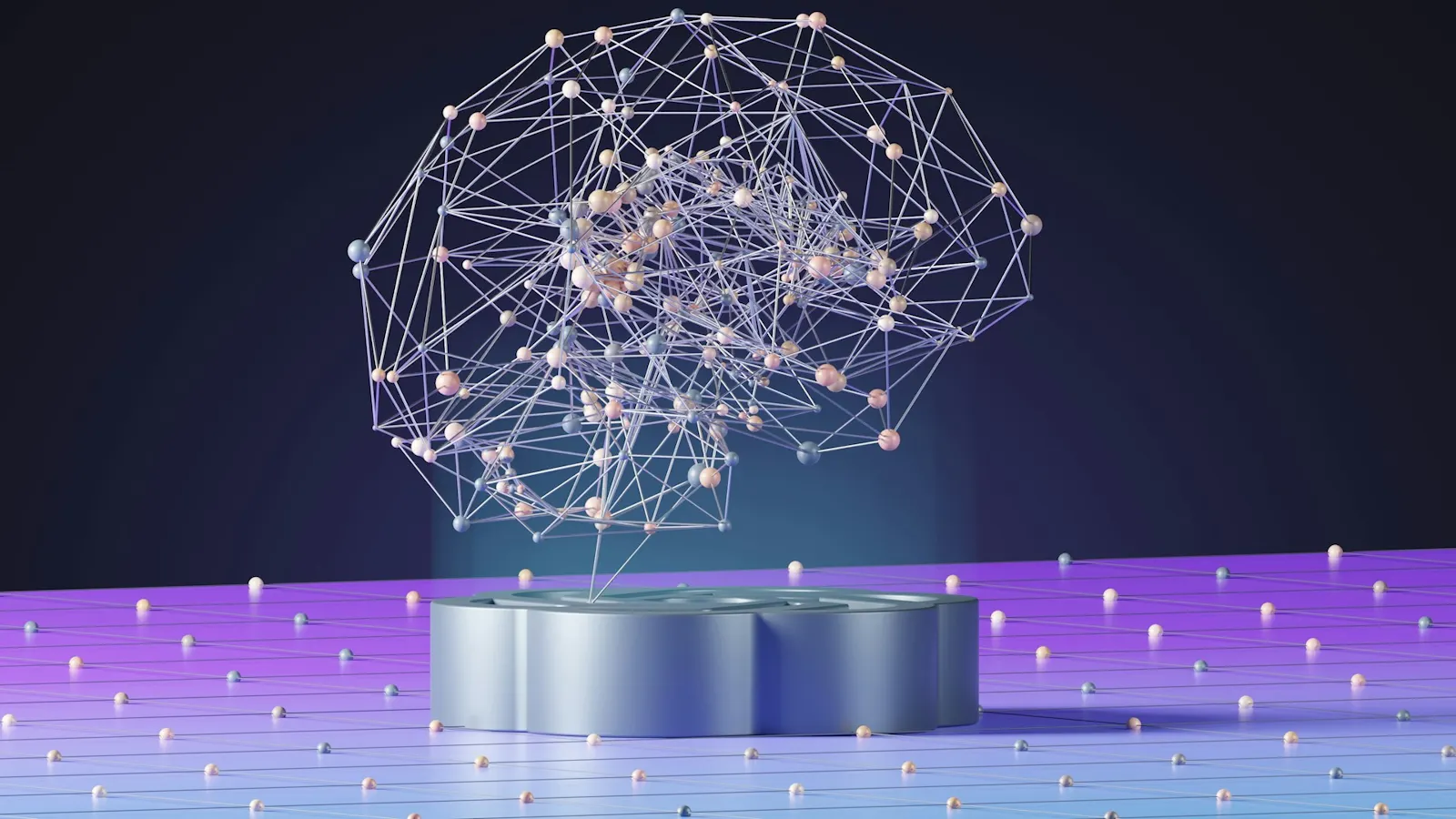
Daneben werden auch strukturell Weichen gestellt. Die Plattform Femmes@numériques, getragen unter anderem vom Digitalministerium, fördert gezielt Mädchen und Frauen in Tech-Ausbildung und technischen Berufen, etwa mit Mentoring-Programmen, Aufklärungskampagnen und Weiterbildungsfonds. Der Verein „DesCodeuses“ geht einen Schritt weiter und bietet Frauen aus prekären Verhältnissen kostenlosen Zugang zu Programmierkursen, oft als Türöffner in die digitale Arbeitswelt.
Ergänzt werden diese Initiativen durch den ein Bündnis aus Politik, Forschung und Zivilgesellschaft namens „Pacte pour une IA égalitaire“, das 2023 ins Leben gerufen wurde. Sein Ziel: mehr Frauen in Entscheidungspositionen, geschlechtergerechte Förderstrukturen und eine KI-Politik, die systematisch gegen Diskriminierung kämpft, die etwa entsteht, wenn Algorithmen auf Basis einseitiger Daten bestehende Geschlechterungleichheiten automatisiert reproduzieren.
Deutschland im europäischen Vergleich im Rückstand
Im europäischen Vergleich wird Frankreichs Ansatz und dessen Auswirkungen besonders deutlich. In Deutschland dagegen ist die Beteiligung von Frauen in der KI-Politik weiterhin unterdurchschnittlich. In einem OECD-Bericht (Si apre in una nuova finestra) heißt es etwa: „Bis Januar 2023 wurde keines der sechs deutschen Exzellenzzentren für KI-Forschung von einer Frau geleitet; nur 14 Prozent der Forschenden waren Frauen.“ Frankreich hingegen besetzt Schlüsselposten, wie etwa den CIAN, bewusst paritätisch.

Für Laurence Devillers ist der Unterschied nicht nur strukturell, sondern auch konzeptionell: „Ich bin für die Einführung von Frauenquoten, weil Frauen und Männer nur selten die gleiche Denkweise zu bestimmten Themen haben. Wenn ausschließlich Männer an einem Tisch sitzen, übernimmt einer die Führung und die anderen ziehen mit. Wenn man ein paar Frauen in dieselbe Gruppe setzt, gibt es in der Regel zwei Leader. Es entstehen zwei Ideen, die sich gegenseitig herausfordern – und das führt dazu, dass wir tatsächlich nachdenken.“
Wenn Algorithmen Vorurteile reproduzieren
Technologie ist nicht per se neutral – auch KI kann bekanntlich gesellschaftliche Ungleichheiten verstärken. Denn die Daten, mit denen KI-Systeme trainiert werden, spiegeln oft die Vorurteile und Rollenmuster der Vergangenheit. Wenn hauptsächlich Männer entwickeln, entscheiden sie auch, welche Perspektiven in den Algorithmen sichtbar werden und welche nicht.
„Wenn Technologien von Anfang an nicht für uns [Frauen] mitgedacht werden und später auch schlechter nutzbar sind, ist das eine klare Form von Diskriminierung. Nicht nur, dass wir sie nicht selbst entwickeln, wir können sie auch nur weniger effektiv nutzen“, warnt Laurence Devillers. Ohne gezielte politische Maßnahmen, wie etwa den „Pacte pour une IA égalitaire“, drohen diese Verzerrungen verfestigt und technisiert zu werden.
Frankreich scheint diesen Zusammenhang erkannt zu haben und gegensteuern zu wollen: mit Förderprogrammen, Bildungsprojekten, Ethikgremien und einer klaren Parität in Entscheidungsstrukturen. Der nationale Aktionsplan sieht vor, dass bis 2030 mindestens 50 Prozent der neuen Jobs im digitalen Sektor mit Frauen besetzt sein sollen. Noch liegt der Anteil unter 30 Prozent – das Ziel aber ist gesetzt. Denn die Zukunft der KI wird nicht nur von Rechenleistung bestimmt, sondern davon, wessen Stimme sie trägt.


