Der Corona-App-Mann: Erst Ministerium, dann Millionen-Konzern

Der Mann, der einen der teuersten Technologieaufträge in der Geschichte der Bundesrepublik maßgeblich mitverantwortete, tauchte kurz nach dessen Umsetzung in den Schatten ab – um wenig später bei genau jenem Konzern aufzutauchen, dem er zuvor, ohne Ausschreibung, Millionen an Steuergeldern zugeschanzt hatte.
Gottfried Ludewig. CDU. Ein Name, den man sich merken sollte.

Als Leiter der Abteilung „Digitalisierung und Innovation“ im Bundesgesundheitsministerium (BMG) war Ludewig federführend für die Steuerung der Corona-Warn-App zuständig. Eine App, die nicht nur als digitales Bollwerk gegen das Virus, sondern auch als Beweis deutscher Verwaltungsfähigkeit verkauft wurde. Was sie in Wahrheit war: ein Lehrstück über intransparente Vergabepraktiken, politisch-industrielle Verflechtungen – und die vollständige Abwesenheit öffentlicher Kontrolle. Heute arbeitet Ludewig für T-Systems – jenem Unternehmen, dem er zuvor ohne Ausschreibung den Millionenauftrag für die Corona-Warn-App verschaffte.
Ohne Ausschreibung. Ohne Wettbewerb. Mitten in der Krise.
Während ganz Europa mühsam Open-Source-Lösungen evaluierte, Partner suchte, Ausschreibungen vorbereitete – ging es in Deutschland plötzlich ganz schnell. SAP und T-Systems, die Telekom-Tochter, wurden im April 2020 direkt mit der Entwicklung der App beauftragt. Keine öffentliche Ausschreibung. Kein Bieterverfahren. Kein Wettbewerb. Dafür ein „Notstand“, der alles rechtfertigte.
Zwölf Wochen später war die App live. Der Öffentlichkeit wurde das als technologische Glanzleistung verkauft. Der eigentliche Rekord aber war die Geschwindigkeit, mit der ein Milliardenkonzern und eine Ex-Staatsfirma von der Krise profitierten – auf direktem Wege und ohne Kontrolle.
Zwölf Wochen – vom Regierungsauftrag bis zur fertigen App. Ein erstaunliches Tempo in einem Land, in dem selbst Faxgeräte als Verwaltungstechnologie durchgehen. Die Frage drängt sich auf: Wie konnte ein Projekt dieser Größenordnung ohne Ausschreibung, mit Millionenvolumen, in dieser Geschwindigkeit umgesetzt werden? Wer hat hier eigentlich mit wem gesprochen – und vor allem: wann?
War der Notstand tatsächlich der Grund für den Verzicht auf jede Form von Vergabeverfahren? Oder war er nur das argumentative Feigenblatt für ein längst verabredetes Projekt zwischen Ministerium und Konzernen? Denn dass zwei Unternehmen wie SAP und T-Systems aus dem Stand heraus eine technisch komplexe, datenschutzsensible App entwickeln konnten, lässt nur zwei Möglichkeiten zu: Entweder sie wussten sehr früh von ihrem Glück – oder es wurde nie ernsthaft erwogen, auch nur jemand anderen zu fragen.
Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Krise zur Einbahnstraße für Auftragsvergabe wird. Doch selten war sie so lukrativ – und so undurchsichtig.
Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache
Was für andere europäische Länder wenige Hunderttausend Euro kostete, wuchs sich in Deutschland zu einem haushaltspolitischen Monster aus.
Ursprünglich veranschlagt: 20 Millionen Euro.
Tatsächliche Kosten bis 2023: über 214 Millionen Euro.
Davon allein 73 Millionen im Jahr 2022 – ein Jahr nach dem ersten Pandemiehöhepunkt.
Hotlinebetrieb, Serverkosten, Weiterentwicklung – immer neue Beauftragungen, neue Module, neue Updates.
Kosten pro gewarnter Infektion: über 18 Euro. In manchen Zeiträumen war die Zahl positiver Meldungen sogar verschwindend gering im Verhältnis zur Nutzerzahl.
Kein Untersuchungsausschuss. Kein Rechnungshofbericht, der sich durchsetzen konnte. Nur die üblichen Stellungnahmen aus Ministerien, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Und mittendrin: Ludewig. Der Mann, der diese Verträge koordinierte – und bald darauf den Sessel wechselte.
Vom Auftraggeber zum Profiteur
Ende 2021 wird publik, was in einem funktionierenden demokratischen System mindestens eine Untersuchung ausgelöst hätte: Gottfried Ludewig, bis dahin als Leiter der Digitalabteilung im Gesundheitsministerium mit zentraler Verantwortung für Entwicklung, Einführung der Corona-Warn-App betraut, verlässt seinen Posten – und wechselt zur Deutschen Telekom, genauer: zur Konzern-Tochter T-Systems, die in seinem Verantwortungsbereich mehrfach mit staatlich finanzierten Großaufträgen betraut wurde.

Dass Ludewig in seiner aktiven Zeit auf Seiten des Bundes jene Strukturen orchestrierte, die T-Systems zum technischen Hauptdienstleister der App machten, ist dokumentiert. Dass er anschließend als Führungskraft in genau dieses Unternehmen eintritt, wurde von der Politik nicht infrage gestellt – obwohl der Wechsel auf dem Papier exakt das verkörpert, wovor jede Compliance-Schulung warnt: Interessenkonflikt durch unmittelbare persönliche Vorteilsnahme.
Die juristische Begründung für das politische Wegsehen ist simpel, aber entlarvend: Ludewig war kein Minister, sondern Beamter. Damit fiel er nicht unter die 2015 eingeführte Karenzregel, die den Seitenwechsel zwischen Politik und Wirtschaft regulieren soll – eine Regel, die ausgerechnet jene Schlüsselakteure nicht erfasst, die in Ministerien die Fäden ziehen und faktisch Milliardenaufträge gestalten. Es ist ein technokratischer Graubereich, der in der Pandemie zur offenen Einladung wurde: Entscheiden, gestalten, beauftragen – und später selbst einsteigen.

Ludewigs Wechsel war dabei keine symbolische Besetzung, sondern ein Karrieresprung in eine Schlüsselstelle – ausgestattet mit detailliertem Insiderwissen, direktem Zugang zu Behördennetzwerken und tiefem Verständnis für interne Entscheidungsprozesse. Es ist dieser Informationsvorsprung, der den eigentlichen Wert eines solchen Wechsels ausmacht – und der ihn so brisant werden lässt. Denn T-Systems profitierte nicht nur bei der App: Auch spätere Folgeaufträge, technische Weiterentwicklungen und staatlich finanzierte Wartungsverträge liefen über den Konzern.
Dass dieser Seitenwechsel weder intern noch extern geprüft wurde, dass keine Offenlegungspflicht greift, dass keinerlei parlamentarische Kontrolle stattfand – all das verweist auf ein strukturelles Problem: Die Kontrollmechanismen des Staates enden exakt dort, wo sie am dringendsten gebraucht würden.
Der Deal der digitalen Epoche
Was Ludewig im Ministerium tat, war – formaljuristisch – legal. Was er danach tat, war – politisch – ein Skandal. Doch die Architektur dieses Skandals besteht nicht nur aus einem Seitenwechsel. Sie zeigt exemplarisch, wie die Digitalisierung der Verwaltung zur Projektionsfläche für Konzerninteressen wird. Wie Notstände genutzt werden, um Ausschreibungen zu umgehen. Wie der Apparat in der Krise nicht transparenter, sondern undurchsichtiger wird.
Die Corona-Warn-App wurde als Open-Source-Projekt beworben. Tatsächlich war sie von Beginn an ein Closed-Shop zwischen Ministerium, Großkonzern und Telekom-Apparat. Die Veröffentlichung auf GitHub war Schaufenster. Die eigentlichen Deals fanden woanders statt.
Und das Geld?
Was ist mit dem Geld passiert? Wo sind die 214 Millionen Euro geblieben?
Natürlich gibt es Rechnungen. Es gibt Beauftragungen. Wartungskosten. Hotlines. Infrastruktur. Doch in einem funktionierenden demokratischen Haushaltssystem wären solche Summen Anlass für eine öffentliche Debatte. Für kritische Nachfragen. Für Rechenschaft. Nichts davon ist geschehen. Stattdessen wurde das Projekt 2023 in den „Schlafmodus“ versetzt. Lautlos. Geruchlos. Verantwortungslos. Der Link coronawarn.app (Opens in a new window) führt mittlerweile auf eine Online Poker Seite.
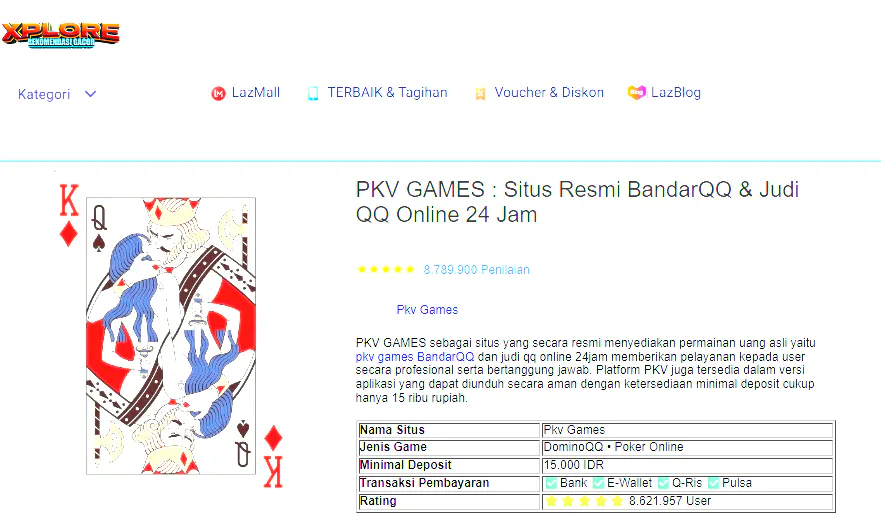
Das Schweigen danach
Niemand will mehr über die App reden. Weder Jens Spahn, der sie politisch mit durchdrückte. Noch Olaf Scholz, unter dessen Kanzlerschaft das Projekt im Sande verlief. Noch Karl Lauterbach, der später das Projekt fortschreiben ließ, ohne die zentralen Fragen zu stellen:
Wieso wurde diese App ohne Ausschreibung vergeben?
Wieso wurden ausgerechnet SAP und T-Systems beauftragt?
Wieso durfte ein Beamter wie Ludewig nahtlos in den Konzern wechseln, den er zuvor mit öffentlichen Geldern versorgte?
Wieso interessiert das niemanden mehr?
Schlussbild einer Demokratie, die ihre Kontrollinstinkte verloren hat
Die Geschichte der Corona-Warn-App ist nicht nur die Geschichte einer ineffizienten App. Sie ist das Symbol einer strukturellen Amnesie, in der Vergabeprozesse, Verantwortungsdiffusion und Lobbyismus ineinander übergehen. Die Debatte ist vorbei, bevor sie je begonnen hat.
Und Ludewig? Er sitzt heute in leitender Funktion bei der Telekom – mit besten Kontakten ins Ministerium. Dort, wo man in der Pandemie gelernt hat: Wenn’s schnell gehen muss, fragt niemand mehr nach dem Preis. Und schon gar nicht nach dem, der ihn festlegt.


