Wie Bürger:innenbeteiligung Demokratie stärken kann
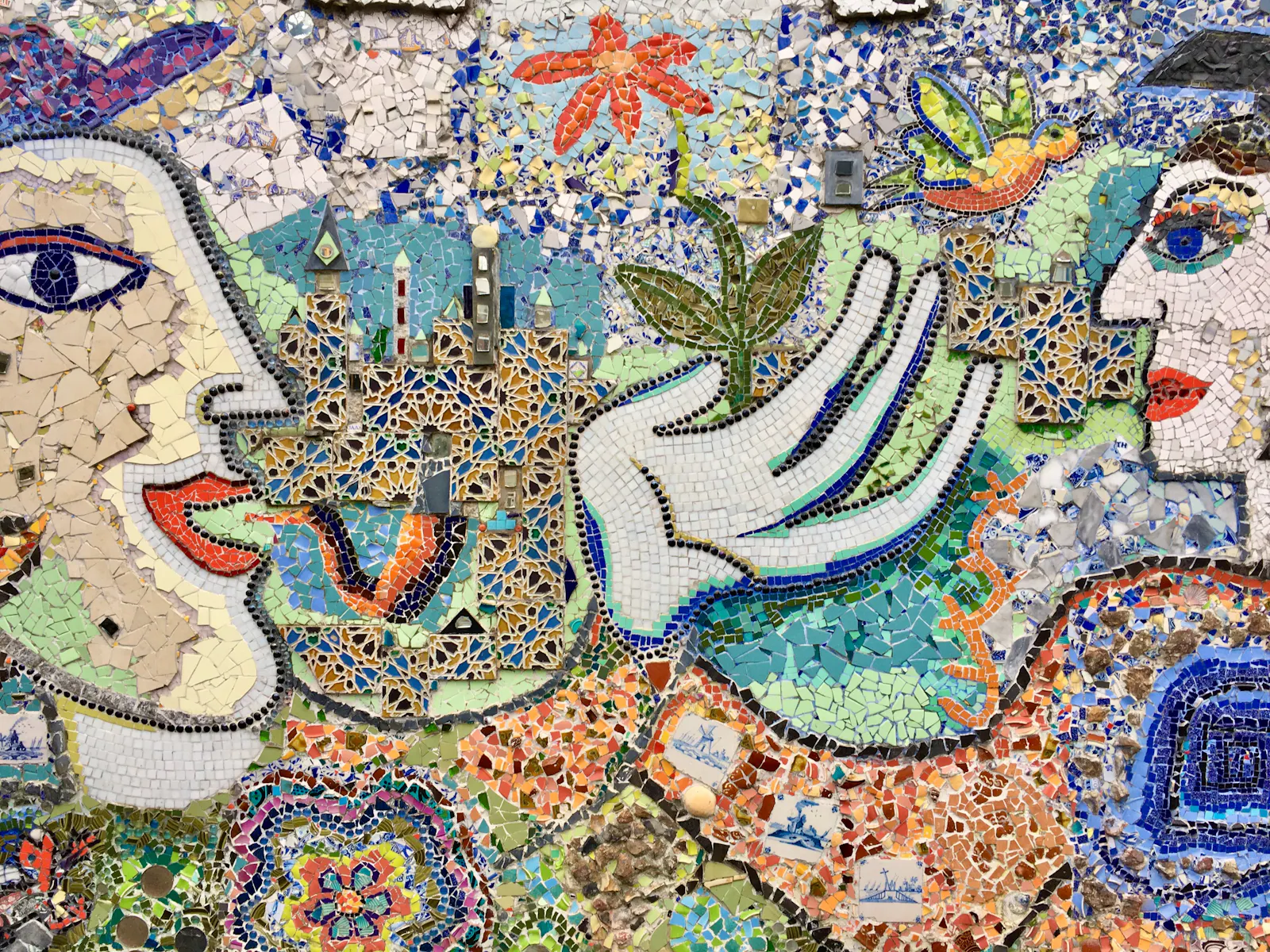
Letzten Monat durfte ich zusammen mit Isabell Gall vom ADFC Sachsen e.V (Öffnet in neuem Fenster). in einer sächsischen Gemeinde einen Bürgerdialog mit Jugendbeteiligung moderieren, der mich sehr berührt hat. Möglich wurde die Veranstaltung durch die Förderrichtlinie Bürgerbeteiligung (Öffnet in neuem Fenster) des Landes Sachsen. Der ADFC Sachsen hat mithilfe der Fördermittel ein Projekt zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Verkehrsplanung initiiert und in Projekttagen an Schulen sowie darauf aufbauenden Bürgerdialogen umgesetzt.
Neben ein paar Jugendlichen nahm der Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder, Schulleiterin, Eltern und weitere Bürger:innen teil. Inhaltlich ging es darum, wie die Verkehrsplanung in der Gemeinde so verändert werden kann, dass die Schüler:innen sicherer und aktiver (z.B. Fahrrad statt „Eltern-Taxi“) zur Schule kommen können. Allein inhaltlich war das angesichts der Situation dort ein super relevantes Anliegen.
Doch was mich neben dem wirklich guten inhaltlichen Ergebnis fast noch mehr bewegt hat, war es, die Erkenntnisse von ein paar der Jugendlichen am Ende der zweistündigen Veranstaltung zu hören. In der Abschlussrunde sagten sie zum Beispiel, man würde immer meckern, dass die Politik nichts macht. Aber eigentlich passiert da ganz viel. Und jemand anders meinte mit viel Anerkennung, dass er merkt, dass Politik nicht so einfach ist, wie man immer denkt. Sondern dass da viel dran hängt an Menschen, Richtlinien und viel zu beachten ist.
Für mich ist das echte Demokratiebildung und gerade in einer Gemeinde, in der ca. 40% zuletzt eine verfassungsfeindliche Partei gewählt haben, so viel wert.
Gleichzeitig hat sich für mich nochmal bestätigt, dass das Thema „Zusammenarbeitsdesign“ nicht nur für Teams und Organisationen relevant ist. Auch für gelingende Kooperation in Bürgerbeteiligungsverfahren muss sowohl strukturell/methodisch als auch kulturell einiges beachtet werden.
Sicherlich wäre die Veranstaltung deutlich weniger produktiv und zufriedenstellend abgelaufen, hätten wir die Teilnehmenden „einfach mal reden“ lassen. Um einen produktiven, ergebnisorientierten Dialog auf Augenhöhe zu fördern, haben wir uns stattdessen für folgende Struktur entschieden, die wir mehrmals wiederholt haben:
Präsentation der Vorschläge: Die Schüler:innen stellen jeweils einen ihrer vier Vorschläge aus dem vorangegangenen Projekttag vor.
Verständnisfragen: Was haben die Erwachsenen noch nicht verstanden?
Wertschätzungsrunde: Die Erwachsenen können sagen, was ihnen an dem präsentierten Vorschlag gefällt (keine Kritik!).
Umsetzungmöglichkeiten besprechen: Gemeinsam schauen, ob sich der jeweilige Vorschlag umsetzen lässt oder wie er adaptiert werden müsste, um die zugrundeliegenden Problematiken zu lösen; Fokus auf das, was möglich ist, statt auf das, was nicht geht.
Zudem haben wir die Teilnehmenden auf zwei Prinzipien hingewiesen:
„Zuhören um zu verstehen – nicht um zu antworten“
“Eine Diskussion kann nur von allen gewonnen werden oder von niemanden“
Und als Moderatorinnen haben wir diese Strukturen und Prinzipien nicht nur vorgestellt, sondern haben auch sichergestellt, dass sie von allen eingehalten werden. Wir haben die Teilnehmenden freundlich, aber klar darauf aufmerksam gemacht, wenn sie davon abwichen.
All diese Maßnahmen haben mehrere positive Effekte:
Man stellt sicher, dass alle über dasselbe sprechen und nicht durch Missverständnisse Probleme entstehen
Durch die Wertschätzungsrunde wird der Blick auf das Positive und das Mögliche gelenkt. Zudem sind die wertgeschätzten Schüler:innen anschließend eher offen, über mögliche Herausforderungen ihrer Vorschläge zu sprechen
Auf der Basis der vorangegangenen Schritte lassen sich viel zielgerichteter Umsetzungsmöglichkeiten erörtern
Man muss sagen: Dies ist noch eine ziemlich simple Methodik. Längere, größere und komplexere Bürgerbeteiligungsverfahren bedürfen einer ausgefeilteren Methodik, als das, was wir gemacht haben. Aber für unseren Zweck hat es gut funktioniert.
Kulturell hat der Dialog aus meiner Sicht sehr davon profitiert, dass es einen Bürgermeister gab, der offen und auf Augenhöhe mit den Jugendlichen umging und im Umsetzungs- statt Problemmodus agiert hat, es einen respektvollen Umgang über Parteigrenzen hinweg gab und es insgesamt unter den Teilnehmenden eine zugewandte Gesprächskultur mit Raum für unterschiedliche Perspektiven gab.
Diese produktive Kultur war ein echter Vorteil. Sie lässt sich aber auch bewusst stärken, zum Beispiel indem man am Anfang (wie wir es in Teilen auch gemacht haben) ein paar Übungen zum „Miteinander warm werden“, zur Stärkung der Zuhör- und Dialogkompetenz u.ä. macht. Und natürlich ist hier auch die oben erwähnte, stringente und gleichzeitig wertschätzende Moderation wichtig.
Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass im Raum verschiedene „Stakeholder“ anwesenden waren, deren Hintergründe, (Entscheidungs-)Möglichkeiten, Kontakte und Ressourcen zusammengenommen mehr Chancen aufgetan haben, als wenn es eine homogene Gruppe gewesen wäre. Das ist eine der vielen Chancen von Bürgerbeteiligungsverfahren – insbesondere, wenn es nicht nur um Meinungsbildung, sondern auch um Umsetzungsmöglichkeiten gehen soll.
Mir war es eine große Freude, diesen Bürgerdialog zu begleiten, und ich hoffe, bald wieder so eine Möglichkeit zu haben 😊
In meinem Nachtrag zu diesem Artikel findest du einige Ressourcen zu Bürger:innenbeteiligung.
Was ist dir beim Lesen dieses Artikels durch den Kopf gegangen? Schreib mir gerne an mail@lynvonderladen.de (Öffnet in neuem Fenster). Ich freue mich über Rückmeldungen 😊
Herzliche Grüße
Lyn
Wenn du meinen Newsletter »Zusammenarbeit gestalten« magst und mich gerne unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du eine Mitgliedschaft (Öffnet in neuem Fenster) abschließt. Das geht schon ab 3 Euro/Monat und ermöglicht mir, ihn weiterhin regelmäßig zu schreiben 🧡
Über Lyn von der Laden
Als freiberufliche Wirtschaftspsychologin begleite ich Teams und Organisationen, ihre Zusammenarbeit wirksam und freudvoll zu gestalten. Außerdem unterstütze ich Menschen in Einzelcoachings, stimmige Antworten auf individuelle Herausforderungen zu finden.
Du findest mehr zu mir und meine Arbeit auf www.lynvonderladen.de (Öffnet in neuem Fenster) und erreichst mich unter mail@lynvonderladen.de (Öffnet in neuem Fenster).


