Wehrpflicht und Feminismus
Während Deutschland mit massiver Aufrüstung „wehrhaft“ und „kriegstüchtig“ gemacht werden soll, wird nun auch die Forderung nach einer Wehrpflicht für Frauen als feministisch geframed. Ein Widerspruch.
Die Missy-Herausgeberinnen und Journalistinnen Sonja Eismann, Chris Köver und Margarita Tsomou zur Wehrpflichtsdebatte für Frauen.
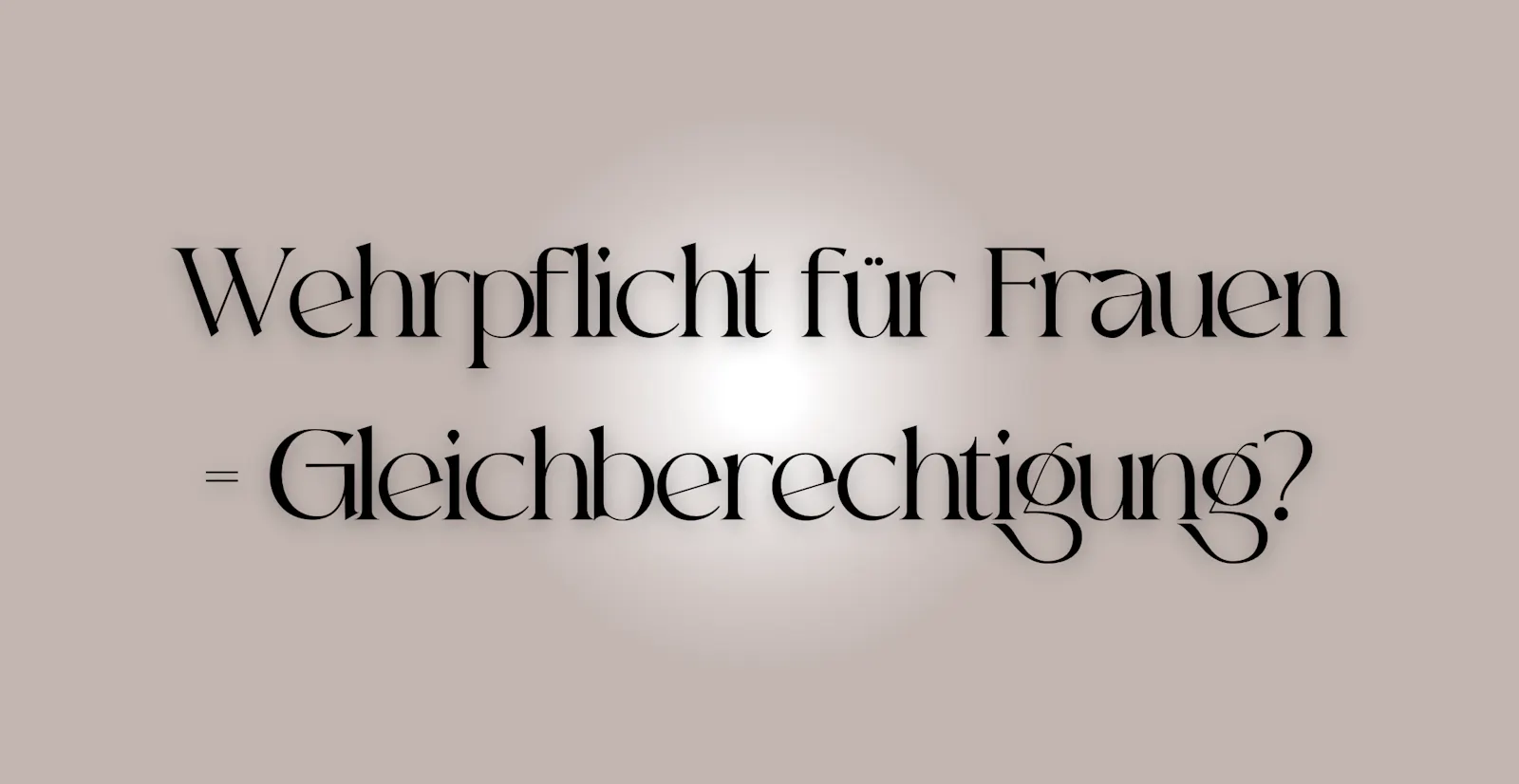
Die Sprache wird schärfer. Täglich reden Politiker*innen und Medien über neue Kriegsgefahren, geostrategische Taktiken und mehr Geld für Rüstung. Begriffe wie Wehrhaftigkeit und Kriegstüchtigkeit dominieren die Debatte, während nicht-militärische Lösungen und politische Ansätze in den Hintergrund treten. Die Militarisierung der Gesellschaft ist in vollem Gange.
Politiker*innen, oft selbst nicht mehr wehrfähig, fordern die Rückkehr zur Wehrpflicht – auch für Frauen. Häufig kommt diese Forderung von Personen, die selbst nicht betroffen wären, aber großzügig ihre eigenen und die Kinder anderer in die Pflicht nehmen.
Diese Entwicklung reicht bis in feministische Kreise hinein. Sie erinnert an die Kriegsbegeisterung liberaler Frauenrechtlerinnen im Ersten Weltkrieg (Öffnet in neuem Fenster), die auf mehr Gleichberechtigung hofften und unermessliches Leid mitverursachten. Heute hallt diese nationalistische Ideologie in Rufen wider, das „Privileg der Gleichberechtigung“ mit der Pflicht zu bezahlen, unsere Demokratie – sprich: unseren Nationalstaat – als Soldat*innen (mit Sternchen) zu verteidigen. Das hier beschworene nationale „Wir“ verlangt Opfer und die „Übernahme von Verantwortung“ für „unsere Werte“.
Die Idee, das eigene Leben für das Gemeinwohl zu riskieren, ist eine alte Trope, die in jeder kriegerischen Mobilmachung und von jeder Nation ins Feld geführt wird. Neu allerdings ist, dass dafür nicht die Vaterlandsfahne geschwenkt wird, sondern die des Feminismus.
Statt der veralteten Rhetorik von Patriotismus wird jetzt Feminismus zur pinken Glasur der soldatischen Heldenerzählung. Dass das patriotische „Wir“ von einem diversitätssensiblen ersetzt wird, täuscht darüber hinweg, dass mit diesem „Wir“ die Bevölkerung hinter einer Nation zusammengeschweißt wird, die Grenzen für Asylsuchende schließt, rassistische Migrationspolitik betreibt, Waffen in Unrechtsregime liefert und Frauenhäuser sowie Diversitätsprojekte schließt.
Während mit solchen Politiken immer neue Ausschlüsse produziert werden, sitzen „Wir“ aber alle vorgeblich im selben Boot, wenn es um das Sterben für Deutschland geht. Gleichberechtigung ist das nicht. Es ist ein verkürzter Feminismus, der Fortschritt darin sieht, wenn nun auch FLINTA patriarchale Gewaltstrukturen nachahmen.
Der Klischees von Schwäche und Schutzbedürftigkeit von FLINTA entledigen wir uns nicht, indem wir uns toxischer Maskulinität anpassen. In dieser Logik müssten wir begrüßen, dass nun auch Frauen wie Alice Weidel oder Marine Le Pen faschistische Führungsfiguren sein dürfen. Doch dass jetzt auch Frauen und Queers für rassistischen Hass und Gewaltbereitschaft stehen können, hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun, sondern mit ihrem genauen Gegenteil.
Russlands Aggressionen befeuern diese Diskussionen und lassen sie legitim erscheinen. Unter dem Deckmantel des Pazifismus ergreifen einige jetzt Partei für Kriegstreiber wie Russland, Rechtsextreme wissen dies zu nutzen. Was wir in dieser Situation brauchen, sind Ansätze, die der Militarisierung entgegenwirken. Die Feministinnen von Pussy Riot (Öffnet in neuem Fenster), die als von Putin verfolgte russische Aktivistinnen seit mehr als zehn Jahren gegen die russische Invasion der Ukraine protestieren, weisen unermüdlich darauf hin, dass es ein wirksames Mittel zur Leerung von Putins Kriegskassen gäbe: Endlich mit den westlichen Sanktionen ernst machen und komplett auf russische Energie verzichten.
Doch das Gegenteil ist der Fall: Laut einer Studie (Öffnet in neuem Fenster) des Forschungsinstituts CREA gaben EU-Staaten 2024 mehr Geld – 21,9 Milliarden Euro – für russische fossile Brennstoffe aus als für Ukraine-Hilfen. Eine Wende ist nicht in Sicht.
Besonders zynisch: Dieselben Politiker*innen, die uns den Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen verwehren, Gewaltschutzgesetze sabotieren und andere feministische Forderungen aktiv behindern, sprechen jetzt von Gleichberechtigung bei der Wehrpflicht. Eine echte Politik der Gleichberechtigung würde in Kitas, Bildung, Gesundheit und Pflege investieren und damit FLINTA entlasten – doch genau diese für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtigen Bereiche fallen der „Zeitenwende“ zum Opfer.
Dabei gab das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in seinem letzten Bericht (Öffnet in neuem Fenster) an, dass Deutschland weltweit auf Platz vier der Nationen mit den größten Militärausgaben (Öffnet in neuem Fenster) steht – nur die USA, China und Russland haben noch höhere Aufwendungen. Deutschland will aber noch mehr, denn die immer wieder heraufbeschworene Drohkulisse suggeriert, dass unsere Leben durch mehr Waffen sicherer würden. Auch wenn in der Forschung wiederholt wird, dass Krieg nicht durch mehr Krieg verhindert wird – was derzeit in der Eskalation der Bombardierungen von Israel und Iran offensichtlich wird. Es ist genau umgekehrt. Mit Bezug auf das derzeitige und seit dem Ende des Kalten Krieges noch nie dagewesene atomare Wettrüsten erklären die Expert*innen (Öffnet in neuem Fenster) von SIPRI: „Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Atomwaffen keine Sicherheit garantieren (…) Sie bergen auch ein immenses Risiko der Eskalation und Katastrophe.“
Immer mehr Ausgaben für weniger Sicherheit, aber nicht ohne Nutzen für einige: Eine strauchelnde Wirtschaftsnation setzt auf Aufrüstung und hofft, sich damit aus der Krise der Automobilindustrie zu retten. In dieser Logik scheint es weniger wichtig, FLINTA durch eine andere Familienpolitik oder durch Stärkung sozialer Infrastrukturen zu stützen. Priorität ist die Stärkung durch Kriegstüchtigkeit an der Front und an den Waffen.
Natürlich geht es hier nicht um Gleichberechtigung: Das Emanzipationsversprechen eines „Frauen an die Waffen“ kommt als Befreiung daher, ist aber de facto ein pink gewaschener Köder, um die Bevölkerung – egal welchen Geschlechts – darauf vorzubereiten, körperliches Verzehrmaterial eines von Kriegsaussichten befeuerten zeitgenössischen Kapitalismus zu werden. Der Mangel an Kanonenfutter soll auch durch „Gleichstellung“ behoben werden.
Die Debatte um die weibliche Wehrpflicht ist in erster Linie ein rhetorischer Trick, um die Militarisierung zu normalisieren: Während noch lange nicht beschlossen ist, ob die Wehrpflicht überhaupt wieder eingeführt wird, wird durch diese Debatten simuliert, dies sei nur eine Formalität und es gelte jetzt schon die nächste Hürde auf dem Weg zum Krieg zu nehmen: die Mobilmachung der Frauen.
Diese wird jedoch keine Gleichberechtigung bringen, sondern allein die Zementierung des männerdominierten Status Quo. Feminist*innen, die es befürworten, gleichberechtigter Teil patriarchaler Strukturen zu werden – ob in Krieg, Faschismus oder Klimazerstörung –, haben nicht nur das politische Ziel völlig verfehlt. Sie bereiten den Weg dafür, dass Feminismus immer stärker als rechtes, rassistisches Herrschaftprojekt für weiße Frauen vereinnahmt wird – wir bewegen uns damit gefährlich nah an dem, was Sara R. Farris (Öffnet in neuem Fenster) Femonationalismus (Öffnet in neuem Fenster) nennt.
Das Ethos feministischer Politik ist es, Bedingungen dafür zu schaffen, das Leben zu erhalten, nicht den Tod zu produzieren. Die Diversitätsoffensiven der letzten Jahrzehnte verschleiern, dass Feminismus ein gesellschaftliches Transformationsprojekt ist, das die Sorge um das Leben und die Regeneration des Planeten als Primat jeder Politik versteht. Dafür braucht es internationale Solidarität unter Feminist*innen über Grenzen hinweg, nicht das Einreihen ins nationale „Wir“.
Um den Zusammenhang zwischen soldatischer Männlichkeit, Faschismus und Krieg zu verdeutlichen, zitierten Feminist:innen einst Björn Höcke (Öffnet in neuem Fenster), der „wehrhaft“ und „mannhaft“ in eins setzte . Heute gilt „wehrhaft“ als positive Vokabel und Kriege als notwendig. Das ist so weit vom Feminismus entfernt wie der Erste Weltkrieg von heute – zeitlich gesehen. Inhaltlich sind wir erschreckend nah dran.
Sonja Eismann, Chris Köver, Margarita Tsomou
Dieser Text erschien erstmalig am 18.06.2025 auf missy-magazine.de (Öffnet in neuem Fenster)


