Die Spree trocknet aus
NEWS / REKULTIVIERUNG IN DER LAUSITZ
Juni 2023
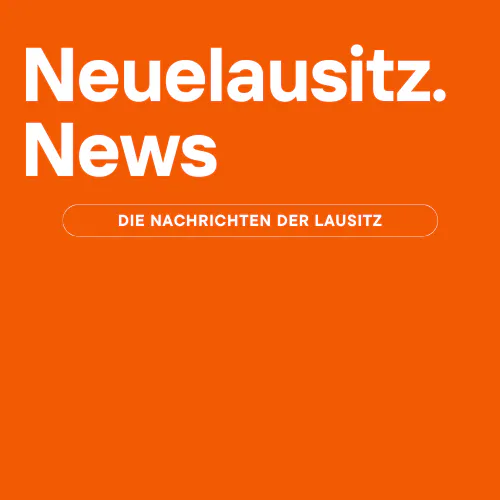
Die Spree wird auf Jahrzehnte hinaus von dramatischem Wassermangel bedroht sein. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag vorgestellte Studie zu den wasserwirtschaftlichen Folgen des Braunkohle-Ausstiegs (Öffnet in neuem Fenster) im Auftrag des Umweltbundesamtes. In zukünftigen Trockenperioden sei mit einem abschnittsweisen Trockenfallen der Spree zu rechnen, heißt es darin. Gegenwärtig besteht demnach die Spree auf Höhe Cottbus zur Hälfte aus Sümpfungswasser. In trockenen Sommermonaten steigt dieser Wasseranteil auf 75 Prozent. Nach dem Ende des Braunkohle-Abbaus werden die eingeleiteten Wassermengen sinken und damit der Fluss deutlich weniger Wasser führen.
Aktuell fehlen laut der Studie der Lausitz rund vier Milliarden Kubikmeter Wasser. Hinzu kommen in den nächsten fünf Jahrzehnten etwa sechs Milliarden, die gebraucht werden, um das fehlende Grundwasser aufzufüllen. Der künftige Wassermangel wird durch die Verdunstung der Bergbaufolgeseen - insgesamt rund 250 Quadratkilometer Fläche - sowie durch die zu erwartenden Wirkungen des Klimawandels zusätzlich verstärkt. Die 260 Seiten lange Studie wurde von Wilfried Uhlmann, Kai Zimmermann, Michael Kaltofen, Christoph Gerstgraser und Carsten Schützel erstellt. Die Wissenschaftler haben hydrologische Daten seit 1855 und Entwicklungskonzepte der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (Öffnet in neuem Fenster) (LMBV) sowie des Energie-Unternehmens Leag ausgewertet.
Wasserstoff-Produktion kaum möglich
In den 120 Jahren seit Beginn der Kohleindustrie wurden fast 60 Milliarden Kubikmeter Grundwasser gefördert. Dieser Eingriff in den Wasserhaushalt hat in den Flussgebieten der Schwarzen Elster und der Spree deutliche Spuren hinterlassen. Damit verschlechtern sich auch wirtschaftliche Aussichten, wie etwa zum Aufbau einer Wasserstoff-Produktion. Diese werde im Spreegebiet nicht in einem größeren Umfang möglich sein.
Die Macher der Studie erwarten eine Konkurrenz um das Wasser zwischen den Industriestandorten Schwarzheide, Schwarze Pumpe, Cottbus und den neu genutzten Kraftwerksstandorten Boxberg und Jänschwalde mit dem Unesco-Biosphärenreservat Spreewald.
Der Wassermangel hat zudem direkte Wirkungen auf die Hauptstadt: Berlin werde bei der Rohwasserbereitstellung für ihr größtes Trinkwasserwerk Friedrichshagen sowie bei der Verdünnung der in das Gewässersystem eingeleiteten Abwässer von jährlich 220 Millionen Kubikmeter vor große Herausforderungen gestellt.
Speicher für 178 Kubikmeter Wasser nötig
Um den Mangel zu entschärfen, empfehlen die Wissenschaftler den Wasserrückhalt in Talsperren. Zudem sollten auch die Bergbaufolgeseen als Reserven für wasserarme Perioden dienen. Der Cottbuser Ostsee etwa müsse zu einem Speicher für 27 Millionen Kubikmeter ausgebaut werden. Insgesamt sind laut Berechnungen mindestens 178 Millionen Kubikmeter Wasserreserve im Spreegebiet nötig, um den Wasserhaushalt nach dem Bergbau zu stabilisieren.
In Reaktion auf die Untersuchung forderte die Linken-Landtagsabgeordnete Anke Schwarzenberg (Öffnet in neuem Fenster)die brandenburgische Landesregierung auf, ein gemeinsames Gremium mit Sachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt und dem Bund einzurichten, das die Finanzierung von Wasserspeichern beschließen soll. Das Umweltnetzwerk Grüne Liga (Öffnet in neuem Fenster) übte Kritik an der Studie. Diese blende die nach dem Verursacherprinzip notwendigen Beiträge der Tagebaubetreiber zur Lösung des Wasserproblems aus und betone stattdesen die Folgen des Kohleausstiegs für den Wassermangel. Die Kommunen der Lausitz-Runde (Öffnet in neuem Fenster) hatten bereits zuvor von Bund und Ländern mehr Bemühungen um den Wasserhaushalt der Spree gefordert. Ein entsprechendes Forderungspapier stellte der Kommunalverbund bei seiner Sitzung am Donnerstag in Forst vor. red


