EIN GARTEN VOLLER DNA
LITERATUR-KRITIK
Hach ja, die allerliebste, böse Familie. Mensch kann nicht mit ihr und nur selten ohne sie. Dies ist wohl einer der Gründe, warum so viele Geschichten um Familienbande und -krisen kreisen. Warum Autofiktion, die häufig um ein Auf- und Entwachsen zirkuliert, einen nahezu ungebrochenen Hype zu haben scheint. Dass da ähnlich wie bei Young oder Dark Romance, Crime, ganz gleich ob Cozy oder True, viel egomanisch-pathetischer Emotions-Schund bei ist, dürfte kaum ein Geheimnis sein (was wir alles nicht besprechen, ihr glaubt es nicht!).
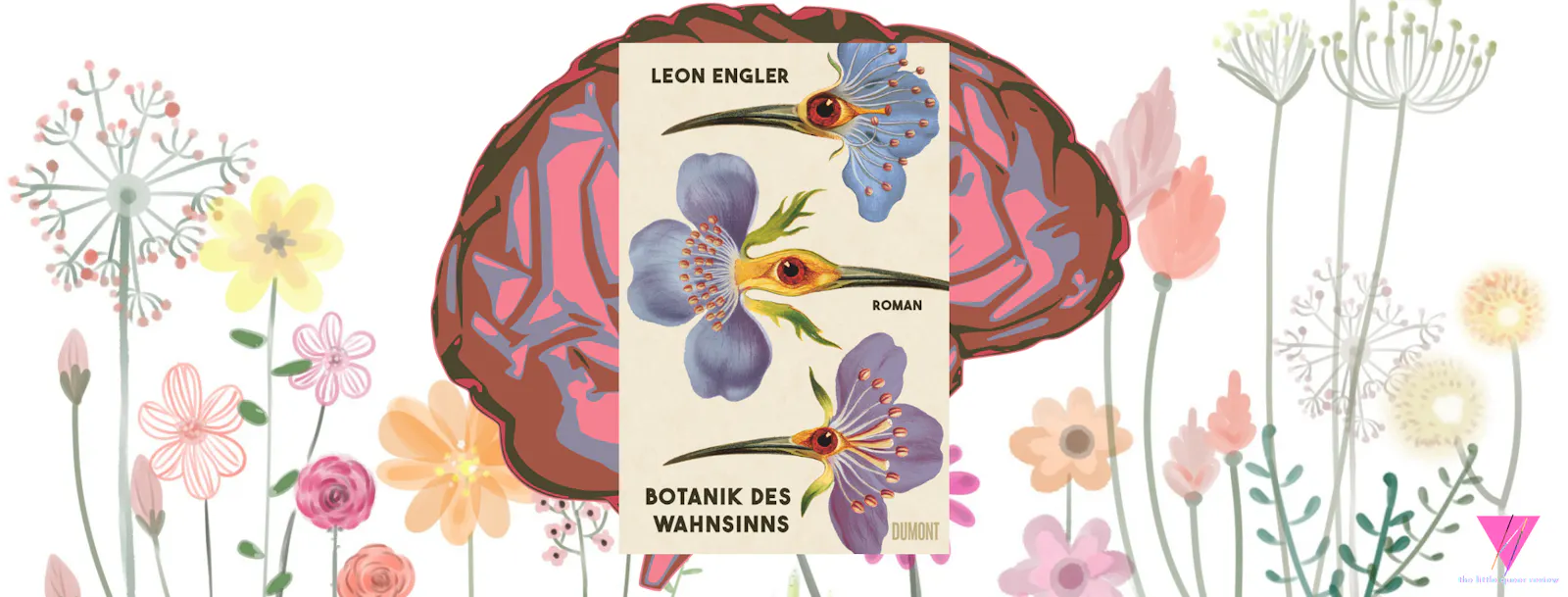
Umso feiner ist es, wenn sich immer mal eine brillante Blüte findet. So wie etwa Leon Englers Debütroman (Öffnet in neuem Fenster) Botanik des Wahnsinns, der heute im Kölner Buchverlag DuMont erscheint und eine wildwachsende Mischung aus Psycho-Fakten und Medizin-Historie, Retro- und Introspektion, Drama und Komödie, krankhaftem Wandern und krankhaftem Heimweh, verschwundener Erinnerung und vererbtem Trauma, Angst und Hoffnung, Depression und Sucht, Therapie und Trinken, Leben und Un-Leben, Vermeiden und Träumen ist. Wobei die zwei letztgenannten im Roman des Bachmann-Wettbewerb-2022-Teilnehmers unweigerlich zusammengehören (ausgezeichnet damals mit dem 3sat-Preis – das ist der Sender, auf dem ihr Bosetti Late Night nicht schaut).
Worum geht es? In aller Kürze (nein, dieses Mal wirklich): Ein junger Mann, der eigentlich Noel heißen sollte, da dies aber nicht genehmigt wurde, nun Leon genannt wird (hmm...) steht vor sieben Kartons in einem dunklen Lagerabteil in Wien. Diese gehörten seiner Frau Mama und warum es ausgerechnet die falschen Kartons sind, erläutert die Autoren-Figur Leon mit feinster Lakonik. Schnell lernen wir zwei Dinge über die Familie:
„Das Leben wurde gelebt, nicht besprochen.“
Und:
„Meine Mutter begab sich in die Klinik. So wie ihre Mutter. Dort machte sie einen Entzug und ließ sich wegen ihrer Depression behandeln. Auch so etwas passierte häufiger.“
Dem Herren Papa und dessen Vater ging es nicht viel anders. Das Ver-rückte liegt also (scheinbar) in der Familie. So hat Leon nun panische Angst selber verrückt zu werden. Oder fürchtet er, der alle möglichen Krankheiten und Phobien benennen kann (super Lexikon, dieses Botanik des Wahnsinns), nicht eigentlich „es nicht zu werden“, wie sein eigentümlicher Nachbar, der ihm ziemlich wörtlich das Denken abnimmt und dafür etwas Leben zurückbekommt, meint?
„Denn es sei ein Aufnahmeritual meiner Familie. So etwas wie ein einziges Gen für Angst oder Melancholie gebe es aber nicht. Eine Veranlagung gebe es. Doch das Leben habe ein Vetorecht.“
Nun stellt sich ihm, uns, womöglich auch Teilen seiner scheinbar semi-fiktionalisierten Umgebung und Familie, die Frage, ob sein Leben dieses Vetorecht nutzen würde. Kleiner Spoiler (eigentlich nicht, steht auf dem Buchrücken): In die Psychiatrie geht es für ihn schon einmal. Wenn auch nicht als Patient, sondern als Psychologe. Also als eine Person, mit der, so lesen wir, manch ein Patient schon einmal gar nicht reden will. Andere dafür umso mehr.
Nun sei Entwarnung gegeben: Der Roman handelt nicht von tiefschürfenden Tiefen-Therapie-Themen. Außer womöglich jener, die Engler über zweihundert Seiten mit sich selber anstellt. Die Familienanamnese ist zwar nicht abgeschlossen, doch zeichnet sich ein deutliches Bild (und für den wachsenden Wahnsinn ist noch Zeit).
https://steady.page/de/thelittlequeerreview/posts/5560863a-45c0-45e1-9336-181707a759e4 (Öffnet in neuem Fenster)Zeit lässt der Real-Life-Psychologe (und Theater-, Film-, Medien- und Kulturwissenschaftler) sich auch immer wieder in seinem Roman. Zwar galoppiert er zügig durch eigene Studien- und Wohnstationen, bis sich das Familienalbum ausgehend von der eigenen Mutter und dem eigenen Vater (vollends) aufblättert, dauert es ein wenig. Es sind Häppchen zu denen Fragen zur Medizin, zum Theater und nicht nur dessen Masken, dem Sinn und Unsinn der Einstufungen von psychischen Krankheiten gereicht werden. (Hier am Beispiel der Homosexualität und der Streichung aus dem ICD: „Über Nacht waren Millionen von Menschen geheilt.“) Ebenso spricht er von Überlastung des Personals wie auch „dem Menschen an sich“. Die Welt ist rau, schick eine Flasche Wein. Oder einen Funken Verständnis sowie ein gutes Ohr.
Auf seinem Weg voller Fragen, die zunehmen, je länger er ihn geht, begegnen er und somit wir noch Carl von Linné – Botaniker UND Mediziner – und dem immerwährenden Sigmund Freud, einer besonderen, da für ihn sehr persönlichen Ingeborg Bachmann, Robert Musil mit einigen Eigenschaften, Friedrich Nietzsche und Michel Foucault (sowieso!), Viktor Frankl und Siri Hustvedt (die den Roman empfiehlt). All dies dank des „Notizbuch des Nachbarn“.
https://steady.page/de/thelittlequeerreview/posts/b183bcbc-c7a4-4a0c-a9d7-10c8ccb2ac98 (Öffnet in neuem Fenster)Die Botanik des Wahnsinns bietet also so einiges auf und ist zweigeteilt, wenn wir so wollen. Der erste Teil ist ein sehr literarischer, schon grenzwertig poetischer. Hier fabuliert Engler viel, bei allem Erdbezug allein durch die der Gesellschaft Entrückten. Übt sich als eine Art Voyeur des Belanglosen, denn darin, „in den Nebensächlichkeiten, die ungesehen vorbeiziehen“, liege etwas verborgen. Mit seinem Beginn in der Klinik wird er und somit der Roman deskriptiver, forschender, unsicherer, gleichwohl fordernder. Zum Ende schließlich tritt eine scharfe Sanftheit zutage, die unentschlossen wirkt, ob sie die Familie, die Umstände, die Gesellschaft, das Leben oder schlicht Nichts und Niemanden verantwortlich machen, anklagen sollte.
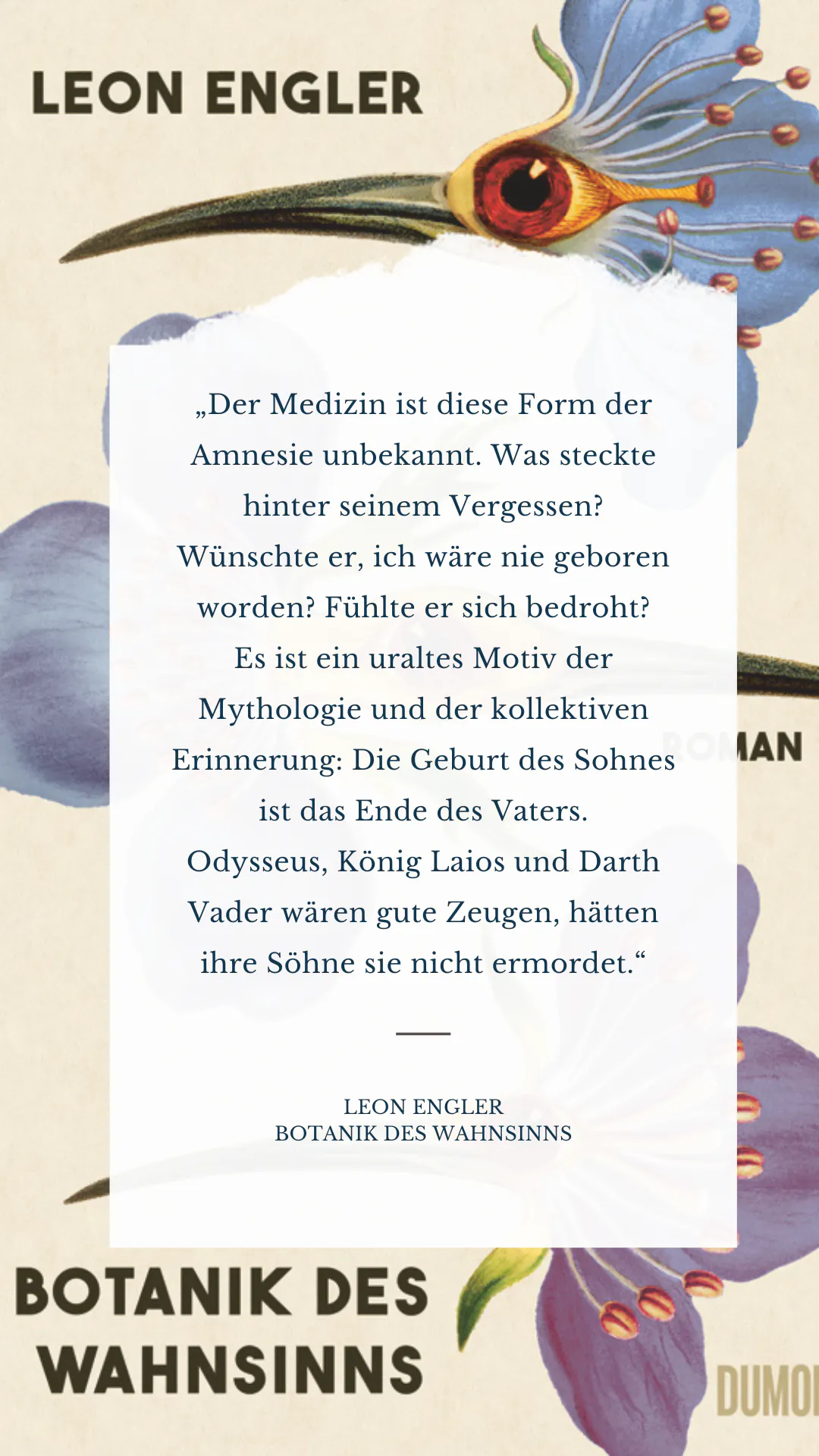
Das ist sprachlich zumeist herb geschliffen. Einige Sätze tänzeln, andere plumpsen, wenige schleichen. Das Banale und Erschütternde wechseln sich ab, manches Mal liegt im einen das andere. Die Notizen und Zitate zum respektive aus dem Wahnsinn sind lang. Aus dem Kontext genommen eröffnen nicht wenige Textteile mannigfaltige Interpretationsoptionen. Was insofern erstaunt, als dass uns Engler durchaus eine Analyse des Erlebten und Gelesenen liefert. Dies zwar für sich selbst, doch wäre es ein Leichtes für uns, sie so zu übernehmen.
https://steady.page/de/thelittlequeerreview/posts/8b92cd0e-8251-44fb-ab4a-942ee447bee5 (Öffnet in neuem Fenster)Ob wir dies wollen, ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Macht mensch es sich leicht oder wuchert er ein wenig mit aus, nach der Lektüre dieses „Protokoll[s] des Verschwiegenen“? Das Sinn ergibt. Wurde zuvor nur gelebt, nicht geredet. Wie zur Befreiung, zum Entkommen, ja zur Rache wird nun geschrieben! Laut geschrieben, dabei voller Witz, voller verzweifelter Zuneigung und einem Hauch achselzuckender Resignation, die jedoch zwischen den Zeilen weniger klar wirkt, als in den fixierten Worten. Theoretisieren wir also (mit) oder fühlen wir (mit)? Geht beides?
Das obliegt euch. Meine Antwort ist klar. Oder doch nicht? (Blickt dabei auf den Zustand seiner Krawatte.)
AS
PS: Zur vermeintlich unstillbaren Gier des Bibers sei der Essayband Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen von Bettina Balàka empfohlen. Dürfte auch etwas für Leon Engler sein, falls er ihn nicht gar schon kennt.
https://steady.page/de/thelittlequeerreview/posts/8981dc84-05c9-44b8-8d84-81f32847f555 (Öffnet in neuem Fenster)PPS: Das, was die Gattin Robert Musils, Martha, mit unliebsamen Einträgen seiner Nachtbücher tat, machte so ähnlich auch Emma Darwin mit Tagebucheinträgen ihres verstorbenen Charles, wie wir in Leor Zmigrods Das ideologische Gehirn lernen. (Neben vielem, vielem mehr – die Rezension folgt in Kürze; ist übrigens als Wissensbuch des Jahres 2025 nominiert (Öffnet in neuem Fenster).)
PPPS: Falls es wen interessiert: Die Angst vor einem Mangel an Lesestoff beziehungsweise Büchern (Öffnet in neuem Fenster) wird als Abibliophobie bezeichnet.
IN EIGENER SACHE: Da unser reguläres Online-Magazin noch immer nicht wieder am Start ist, veröffentlichen wir vorerst hier. Mehr dazu lest ihr in unserem Instagram-Post (Öffnet in neuem Fenster) oder auf Facebook (Öffnet in neuem Fenster). Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt (Öffnet in neuem Fenster) oder uns direkt via PayPal (Mail: info_at_thelittlequeerreview.de) unterstützen mögt.
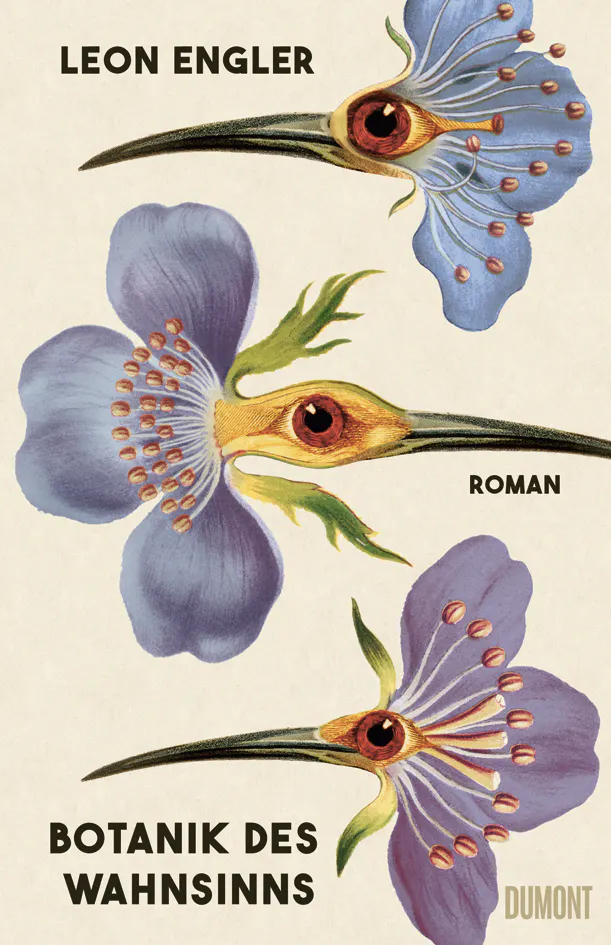
Eine Leseprobe findet ihr hier (Öffnet in neuem Fenster).
Leon Engler: Botanik des Wahnsinns (Öffnet in neuem Fenster); August 2025; 208 Seiten; Hardcover, gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen; ISBN: 978-3-7558-0053-8; DuMont Buchverlag; 23,00 €
– auch als Hörbuch, gelesen von Johannes Nussbaum, erhältlich.


