Nachdenken übers Grübeln (Gastbeitrag Judith Werner)
Über das Denken nachzudenken ist nicht nur das Kerngeschäft der Philosophie, sondern ganz normal, für buchstäblich alle von uns. Manchmal jedoch stehen wir uns gedanklich selbst im Wege, denken zu viel nach, und vielleicht sogar erfolglos – die Gedankengänge verselbstständigen sich, wir würden mit der Denkerei gerne aufhören, doch schaffen es nicht. Das Denken wird zum Grübeln. Meine Philosophenkollegin Judith Werner (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) hat ein lesenswertes Buch zum Thema Grübeln geschrieben: „Besser grübeln – Philosophische Hilfe bei Gedankenschleifen und Overthinking (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)”. Der heutige Gastbeitrag stammt von ihr!
Gedanklich gelähmt
Overthinking kann lähmen. Den Einzelnen, aber auch die Gesellschaft. Wenn die Mühlen der Bürokratie jeglichen Elan zu Frustrationsstaub zermahlen, ist das nicht nur nervig, sondern ein echtes Problem. Das Verzweifeln an mangelnder Innovation und bleiernen Reformstaus gefährdet das Funktionieren eines demokratischen Systems.
Da könnte die Alternative lauten: Einfach machen! Ärmel hoch und mit dem richtigen Mindset wird das schon. Klingt verlockend, macht aber höchstwahrscheinlich nur den YouTube-Coach reich, der einem solche simplen Botschaften teuer verkauft. Was die Macher*innen nämlich gern mal unterschlagen, sind die Umstände, unter denen sie es zu Ruhm und Erfolg gebracht haben. Ein Paradebeispiel dafür ist Kim Kardashian. Mit einem Interview im Jahr 2022 handelte sie sich einen Shitstorm ein, weil sie – gefragt nach einem Karrieretipp – antwortete:
„Krieg deinen verdammten Hintern hoch und arbeite. Es scheint heutzutage so, als würde niemand mehr arbeiten wollen. Du musst dich mit Menschen umgeben, die arbeiten wollen.“
Nun ist an der Aussage, dass man für wirtschaftlichen Erfolg arbeiten muss, per se erst mal nichts verkehrt. Das Generationenbashing (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre), das in der Aussage enthalten ist, ist eine gängige Trope im medialen Diskurs, wenn von der Generation Z die Rede ist. Der eigentliche Aufreger und das, was viele Menschen an Kardashians Aussage verletzte: Sie unterstellt, dass, wer keinen Erfolg hat, sich eben nicht genug angestrengt hätte. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die jeden Tag schuften, um sich und ihre Familien durchzubringen und dennoch gerade so um die Runden kommen. Außerdem gaukelte sie den Angesprochenen vor, dass sie und ihre Familie den Erfolg ihrer ach so hohen Arbeitsmoral verdankten. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Zwar ist ihr kometenhafter Aufstieg den Kardashians nicht gänzlich vor die Füße gefallen – Schönheitsoperationen, Diätpläne, Dauersport und der ewig beurteilende Blick der halben Weltbevölkerung sind sicher kein Spaziergang. Außerdem sehen sich weibliche Unternehmerinnen immer noch einer Mauer aus Misogynie und Vorurteilen gegenüber. Doch davon unbenommen bleibt ein entscheidender Faktor des Kardashian-Imperiums in Kims Aussage unerwähnt. Die Familie war auch vor dem Start ihrer Reality-Show, die den Grundstein für die weiteren Entwicklungen legte, alles andere als unterprivilegiert. Vater Robert Kardashian war Staranwalt und am O.J.-Simpson-Prozess beteiligt. Celebrities gingen ein und aus. Alles ziemlich gute Voraussetzungen, wenn man eine Karriere als TV-Berühmtheit machen will.
Auch der letzte Satz des Kardashian-Zitats bekam jede Menge Hate ab. Denn die Aufforderung, sich einfach mit Menschen zu umgeben, die eben genau die gleiche überpositive Arbeitseinstellung haben, wirkte wie Hohn gegenüber den vielen Angestellten in Billiglohnländern, die die Kleidung für diverse Brands der Kardashians herstellen, die dann im Westen zu teuren Preisen verkauft werden. Diese Marge trägt erheblich mehr zum finanziellen Erfolg eines Unternehmens bei als ein auch noch so strebsamer Geschäftspartner.
Es ist eine gute Nachricht, dass ein solches Statement heute nicht mehr schweigend hingenommen wird – und zwar vor allem für Overthinker*innen: Denn toxisch positive Aussagen sind der perfekte Zunder, um ein emotionales Lauffeuer im Kopf zu entfachen. Dagegen anzudenken, lohnt sich.
Der Kapitalismus und seine Alternativen
Eine Möglichkeit eines solchen Gegendenkens präsentiert die Schweizer Philosophin Rahel Jaeggi (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Sie betreibt Kapitalismuskritik – ein Wort, bei dem sich vielen Menschen die Nackenhaare aufstellen. Klingt es doch für liberale Ohren gleich nach Sozialismus, dem Betongrau der SED-Bauwerke oder als ob demnächst irgendwer wieder die Mauer hochziehen wollen würde. Jaeggi geht es aber gerade nicht darum, Freiheiten einzuschränken, sondern verlorene Freiheiten überhaupt erst wiederherzustellen. Ist es doch eines der kapitalistischen Mantren, dass Anstrengung und Fleiß sich lohnen. Allein, die Statistiken zu Altersarmut nach einem langen Arbeitsleben, unbezahlbaren Mieten selbst mit zwei Gehältern oder das immer stärkere Abschmelzen der Mittelschicht sprechen hier eine ganz andere Sprache.
Jaeggis Ansatz ist deshalb spannend, weil er über die klassischen Gegensätze hinausgeht: Sie teilt nicht in Ökonomie einerseits und Gesellschaft andererseits, sondern betont, dass beide Bereiche sich – im Guten wie im Schlechten – durchdringen. Das wiederum bedeutet aber eben auch, dass es nicht ausreicht, nur einen der beiden Bereiche anzupacken, wenn man sich eine Verbesserung wünscht. Es genügt ein Blick in die moderne Popkultur, um festzustellen, wie sehr sich einst rein private Lebensaspekte einem Diktat des Ökonomischen unterworfen haben. Die Selbstoptimierungsbranche boomt, weil immer mehr Menschen versuchen, in einer Welt der Unwägbarkeiten die Kontrolle zu behalten. Wenigstens über den eigenen Körper. Doch müssen wir uns dieser Logik ergeben und uns mit den Gegebenheiten einer vom Kapitalismus geprägten Welt grundsätzlich abfinden müssen? Jaeggi stellt das in Frage und hält sich dabei aber nicht mit Utopien auf. Stattdessen heißt es, gegenwärtige Verhältnisse kontinuierlich auf ihre eigenen Maßstäbe hin zu überprüfen und daraus transformative Schritte abzuleiten. Die Devise ist also nicht Umsturz, sondern systemimmanente Kritik.
Dieser Ansatz ist ein ziemlich smarter Denk-Move, mit dem wir - ganz ohne Eskapismus - unproduktiven Denkschleifen entkommen und einer sich gerade im Alltag nur zu leicht breitmachenden Verzweiflung über bestehende Verhältnisse entgegentreten können. Denn soziale Veränderung wird weder durch Rückwärtsgewandtheit noch durch das Entwerfen von Idealvorstellungen erwirkt, sondern indem die Widersprüchlichkeit der Gegenwart anerkannt und mit Hilfe kontinuierlicher Selbstüberprüfung und Anpassung als Prozess vorangetrieben wird – also durch besseres Grübeln.
Unter allen, die diesen Text in den Sozialen Medien teilen (idealerweise so, dass wir es mitbekommen), verlosen wir ein von Judith signiertes Exemplar von Besser Grübeln!
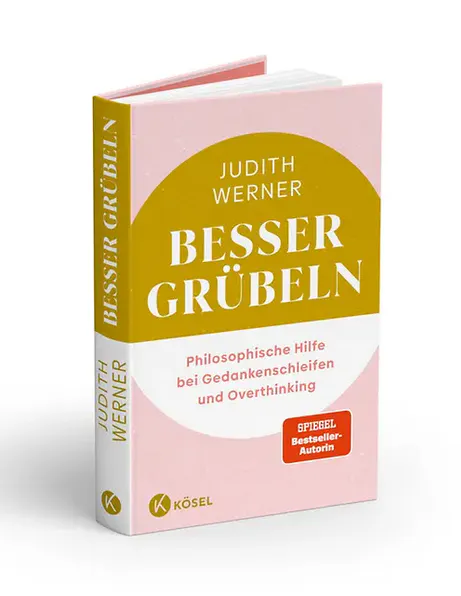 (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)
(S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)Dr. Judith Werner (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) ist Publizistin und Philosophin. Sie kennt sich aus mit Denken, Überdenken, Gedankenschleifen und allem, was sonst noch so in einem kritischen Kopf passiert. Als freie Journalistin, Content Creator und nicht zuletzt auch ganz privat beschäftigt sie sich mit dem Thema Overthinking. Sie schreibt u. a. Für die Süddeutschen Zeitung, der Jüdische Allgemeinen und das Missy Magazine. In ihrem Buch »Danke, nicht gut (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)« erklärt sie, wie man gelassen durch Krisen kommt – ganz ohne toxische Positivität. Dass dabei neben klugen Gedanken auch so etwas wie Wolle und Stricknadeln gute Tools sein können, zeigt sie als Co-Autorin des Spiegel-Bestsellers »Knit is for Power (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)«. Judith Werner lebt mit ihren Gedanken, ihrem Mann, ihrer Tochter sowie Hund und Katze in Bonn. Ihr könnt ihr z.B. auf Instagram (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre) folgen.
https://www.penguin.de/buecher/judith-werner-besser-gruebeln/buch/9783466373437 (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)


