Das Team hinter dem NaziCrimesAtlas: Dr. Edith Raim
Aus Leidenschaft für das Verborgene: Dr. Edith Raim und der lange Weg der Aufklärung

Ein Plakat am Schwarzen Brett ihrer Schule brachte sie zum ersten Mal mit historischer Forschung in Berührung: Edith Raim nahm viermal am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil. Dreimal gewann sie einen ersten Preis – darunter 1983 für eine Arbeit zu den KZ-Außenlagern bei Landsberg am Lech. Ein Thema, das viele damals lieber verdrängten. Doch Raim blieb beharrlich, auch als ihr im Landratsamt Akten plötzlich unauffindbar wurden und der zweite Bürgermeister die Existenz der Lager schlicht leugnete. Sie blieb – und hat diese Haltung nie abgelegt.
Was in der Schule begann, wurde zu ihrem beruflichen Weg. Nach dem Studium in München und Princeton promovierte sie zu eben jenem Thema: den Außenlagerkomplexen Kaufering und Mühldorf. Heute lehrt sie an der Universität Augsburg. Am Institut für Zeitgeschichte in München war sie viele Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Für ein bundesweites Projekt zur juristischen Aufarbeitung von NS-Verbrechen reiste sie quer durch Deutschland, sichtete in Archiven zehntausende Justizakten, transkribierte Verfahren und analysierte deren Verlauf. Später führte sie ihre Recherchen auch in Archiven der DDR fort.
Aus dieser Arbeit entstand die Grundlage für eine neue Form historischer Vermittlung: der NaziCrimesAtlas, ein digitaler Atlas zu nationalsozialistischen Verbrechen – mitentwickelt und wissenschaftlich geleitet von Edith Raim.
Für sie ist der Atlas eine konsequente Weiterführung dessen, was sie als Schülerin begann: verborgene Geschichten sichtbar machen. Jenseits der offiziellen Darstellungen, jenseits der bequemen Narrative.
Auch das Arbeiten im Ausland – fünf Jahre lang als DAAD-Lektorin und Wissenschaftlerin in Großbritannien – hat ihr Blickfeld erweitert. Diese Offenheit zieht sich durch ihr gesamtes Werk: Neben der NS-Zeit hat sie sich auch mit der Geschichte der amerikanischen Besatzungszeit beschäftigt, etwa mit Johnny Cashs Stationierungsjahren in Landsberg. Forschung, sagt sie, braucht Neugier und die Bereitschaft, Fragen zu stellen, wo andere wegsehen.
Im Projekt NaziCrimesAtlas strukturiert sie tausende Einzelfälle in größere Zusammenhänge: Pogrome, Krankenmorde, Verbrechen gegen politische Gegner, Denunziation oder Verbrechen in der Endphase des Kriegs. Dabei bleibt ihre zentrale Frage stets dieselbe: Was erzählen diese Taten über eine Gesellschaft, in der Ausgrenzung zur Normalität geworden war? Und wie erzählen wir diese Geschichte weiter – für eine Generation, die keine Zeitzeugen mehr treffen kann?
Die Antwort gibt sie selbst: Jede Generation schreibt Geschichte neu. Und Edith Raim sorgt dafür, dass dabei nichts verloren geht.
Weiterführende Informationen:
Wer tiefer in die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der frühen Bundesrepublik eintauchen möchte, kann Edith Raims Habilitationsschrift „Justiz zwischen Diktatur und Demokratie. Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in Westdeutschland 1945–1949“ kostenfrei im Open Access lesen:
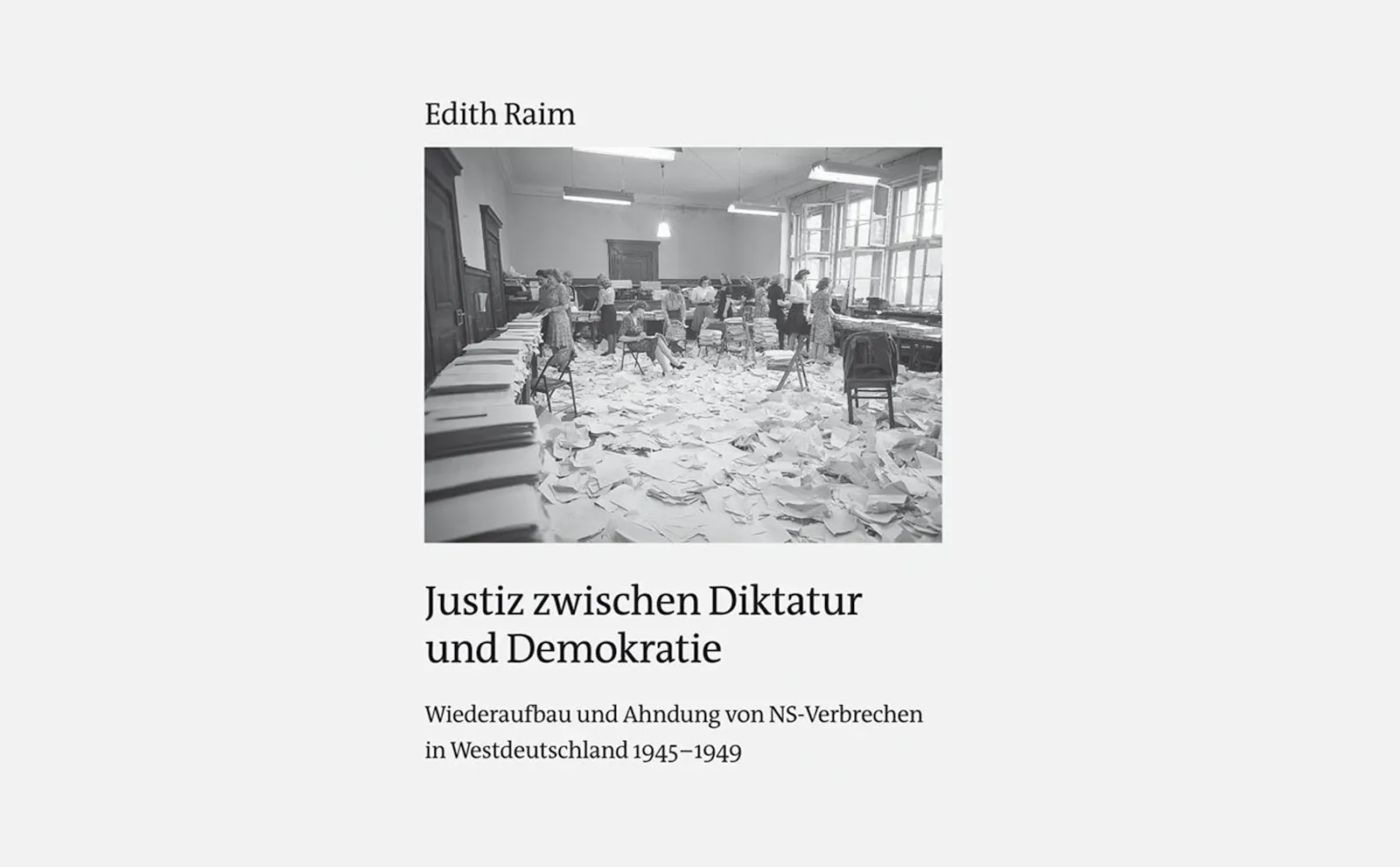 (Abre numa nova janela)
(Abre numa nova janela)Ein persönliches Statement von Edith Raim zur Arbeit am NaziCrimesAtlas finden Sie im Projektvideo:
 (Abre numa nova janela)
(Abre numa nova janela)Förderung
Das Projekt wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.
Empfehlen Sie uns weiter!
 (Abre numa nova janela)
(Abre numa nova janela)


